Elf Millionen Verfassungsrechtler
Ohne große Aufregung hat Tunesien die nächsten Schritte nach dem Tod seines Präsidenten geregelt: Ein Übergangspräsident ist im Amt, die vorgezogenen Neuwahlen sind angesetzt. Doch verfassungsrechtliche Mängel bleiben bestehen. Das könnte ernsthafte Folgen haben.
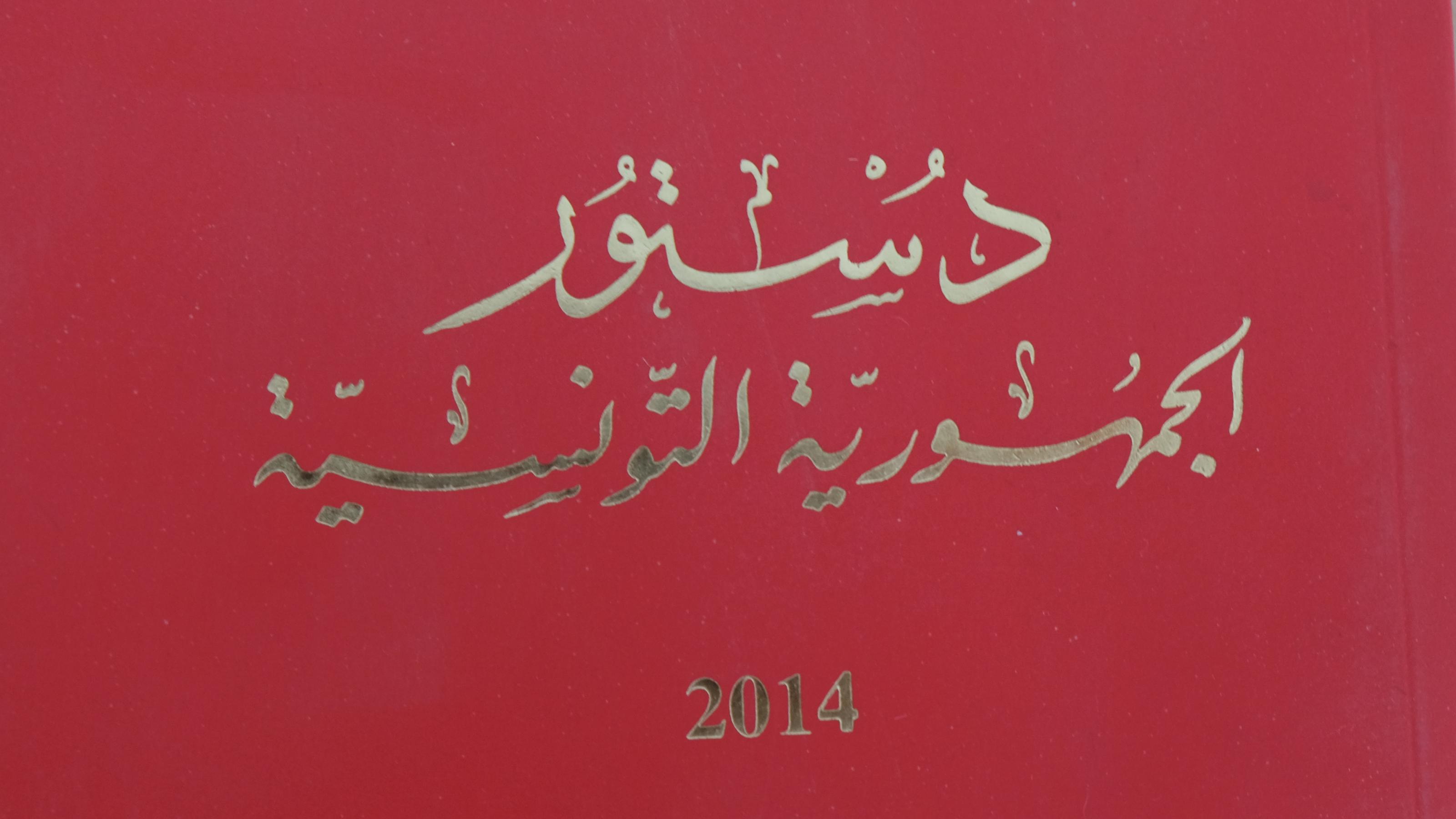
„Früher waren wir elf Millionen Fußballtrainer, seit 2011 sind wir elf Millionen Politikexperten“ lautet ein geflügeltes Wort in Tunesien. Denn mit dem politischen Umbruch hat eine größere Öffentlichkeit die Politik für sich entdeckt. Was in der Diktatur undenkbar war, ist heute Alltag: Offline und online wird über Politik diskutiert, oft laut und meinungsstark. Seit der verstorbene Präsident Beji Caid Essebsi Ende Juni für mehrere Tage im Krankenhaus lag und das Präsidialamt sich in Schweigen hüllte kam eine neue Lieblingsdisziplin hinzu: das Verfassungsrecht. Denn die „beste Verfassung der Welt“, wie sie Mustapha Ben Jaafar, Vorsitzender der Verfassungsversammlung, 2014 nannte, lässt nicht nur, wie die meisten Grundgesetze, eine ganze Reihe an Fragen offen, sie ist vor allem nur in Teilen umgesetzt. Mehrere vorgesehene staatliche Institutionen wurden bis heute nicht geschaffen, allen voran das Verfassungsgericht.
„Das gibt es nur in Tunesien“, schrieb der Jurist Kais Berrjab Ende Juni auf seinem Facebook-Account. „Zwei Terroranschläge und Gerüchte über den Tod des Präsidenten der Republik… und die öffentliche Debatte konzentriert sich darauf, welche Institution zuständig ist, die Vakanz des Präsidentenamtes festzustellen. Eine Debatte, die man sich in anderen arabischen Ländern nicht vorstellen könnte.“
Dass es das Gericht nicht gab, störte lange nur Juristen und Teile der tunesischen Zivilgesellschaft – bis dann im Juni der 92-jährige Präsident im Krankenhaus lag und Gerüchte über seinen Tod die Runde machten, der 85-jährige Parlamentspräsident nach einem Schwächeanfall eine Woche krankgeschrieben war und sein 71-jähriger Vize nach einer lautstarken Meinungsverschiedenheit mit einem Abgeordneten wenige Tage vorher in den Gängen des Parlaments zusammengebrochen war. Da wurde die Frage nach dem Verfassungsgericht auf einmal wichtiger denn je, denn die Verfassung sieht vor, dass das Verfassungsgericht die vorübergehende oder dauerhafte Amtsunfähigkeit des Staatsoberhaupts feststellt.
Wer ist zuständig?
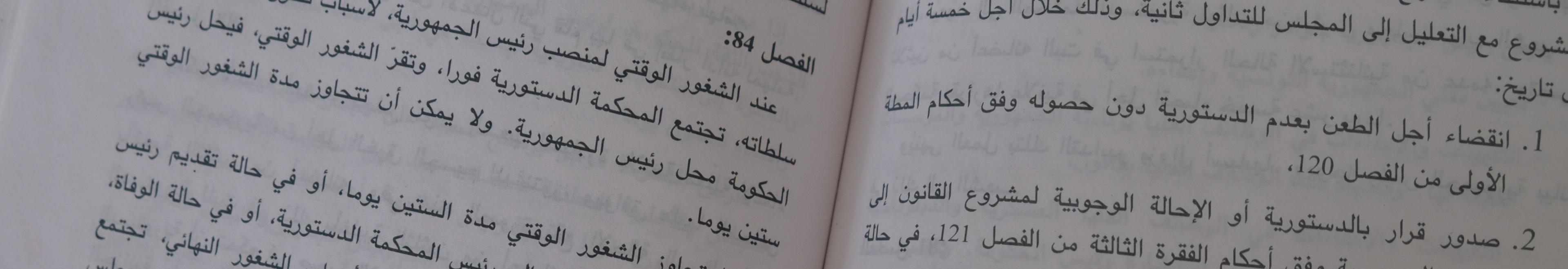
Im Falle einer Amtsunfähigkeit des Präsidenten sehen Artikel 83 ff der Verfassung folgendes vor:
- Im Fall einer vorübergehenden Amtsunfähigkeit delegieren der Präsident oder das Verfassungsgericht die Amtsgeschäfte für einen Zeitraum von maximal zwei Mal 30 Tagen an den Regierungschef.
- Im Fall einer dauerhaften Amtsunfähigkeit, die ebenfalls vom Verfassungsgericht festgestellt werden muss, übernimmt der Parlamentspräsident das Amt für eine Dauer von 45 bis 90 Tagen. Innerhalb dieses Zeitraums müssen vorgezogene Neuwahlen abgehalten werden.
Als Essebsi im Juni mehrere Tage im Krankenhaus lag, völlig unklar war, in welchem Zustand sich das Staatsoberhaupt befand, und das Präsidialamt nur sehr spät und wenig kohärent kommunizierte, gingen die Diskussionen los. Die Öffentlichkeit fragte sich, welcher Fall der Fälle denn nun zur Anwendung käme, sollte es ernst stehen um den Gesundheitszustand des Präsidenten – und ob der mit Essebsi im Clinch liegende Regierungschef Youssef Chahed oder Parlamentspräsident Mohamed Ennacer die Amtsgeschäfte übernehmen würden. Der Politikwissenschaftler Max Gallien hat das ganze damals folgendermaßen dargestellt.
Die Fragezeichen im Schema weisen auf das zweite, grundlegende Problem hin: Das Verfassungsgericht, dass eigentlich spätestens ein Jahr nach Verabschiedung der Verfassung von 2014 seine Arbeit aufnehmen sollte, existiert bis heute nicht. Die Interim-Instanz zur Kontrolle der Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen tut nunmehr seit fünf Jahren, was ihr Name schon sagt; Sie kontrolliert die Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen. Sie hat aber deutlich eingeschränkte Befugnisse im Vergleich zum Gericht.
Fließender Übergang
Das zu ernennende Gericht verfügt über zwölf Mitglieder: Ein Drittel wird vom Parlament gewählt, ein weiteres Drittel vom sogenannten Rat der Magistratur ernannt, also der Vertretung der Richter, und die letzten vier Mitglieder vom Präsidenten. Insgesamt acht Abstimmungen hat das Parlament bereits hinter sich. Doch politische Querelen und Machtspiele haben dazu geführt, dass sich die Abgeordneten bis heute nicht auf die vier zu ernennenden, zukünftigen Verfassungsrichter geeinigt haben – auch nicht bei zwei Sondersitzungen in den vergangenen Wochen, als die Dringlichkeit der Angelegenheit deutlicher denn je war.
Einen Monat lang haben daher seit Ende Juni tunesische Juristen tagein, tagaus diskutiert, wer kompetent sei, die Machtvakanz an der Spitze des Staates festzustellen. Einen Konsens haben sie nicht erreicht. Dass der Fall der Fälle nun eingetreten ist und die verschiedenen beteiligten Institutionen den Machtübergang nach dem Tod von Beji Caid Essebsi mit einiger rechtlicher Akrobatik bestmöglich, in aller Ruhe und Schnelligkeit gelöst haben, steht ihnen gut an. Das eigentliche Problem ist damit jedoch nicht aus der Welt.

Wahlgesetz auf Maß
Denn im Vorfeld der eigentlich regulär für Oktober und November angesetzten Parlaments-und Präsidentschaftswahlen sorgte ein neues Wahlgesetz für eine zweite rechtliche Krise. Von der Regierung Youssef Chahed quasi maßgeschneidert – um kurz vor knapp mögliche populistische Kandidaten wie den Medienmogul Nabil Karoui, die millionenschwere Mäzenin Olfa Terras-Rambourg oder die Anhängerin des alten Regimes Abir Moussi aus dem Rennen auszuschließen – wurde das umstrittene Gesetz von der Interim-Verfassungskontrollinstanz nach einem Einspruch mehrerer Abgeordneter überprüft und für gültig erklärt. Damit begann erneut eine rechtliche Debatte um Fristen, Abläufe und Unterschriften.
Präsident Essebsi hatte die Tunesierïnnen bereits fristgemäß an die Urnen gerufen – und zwar auf Basis des alten Wahlgesetzes, das zu diesem Zeitpunkt noch in Kraft war. Nach dem Urteil der Verfassungsinstanz hätte der Präsident nun drei Optionen gehabt: Er hätte eine Volksabstimmung über das Gesetz initiieren können, oder es zur zweiten Lesung ins Parlament geben können, wo es diesmal eine Zwei-Drittel-Mehrheit benötigt hätte. In beiden Fällen wäre es äußert unwahrscheinlich gewesen, dass sich eine Mehrheit für den Text gefunden hätte. Oder aber, dritte Möglichkeit: Er hätte es ratifizieren müssen, woraufhin es nach Veröffentlichung im Amtsblatt in Kraft getreten wäre. Doch Beji Caid Essebsi ließ alle Fristen verstreichen und tat gar nichts. Wenige Tage vor seinem Tod und nach dem Ablauf der Frist ließ einer der Berater mitteilen, Essebsi habe sich geweigert, das Gesetz zu unterzeichnen.
„Verstoß gegen die Verfassung“
Während die Wahlbehörde öffentlich rätselte, welches Gesetz sie auf die gerade einlaufenden Kandidaturen anwenden solle – ohne sich von der einen oder anderen Seite der Parteilichkeit beschuldigen zu lassen oder die Glaubwürdigkeit der kommenden Wahlen in Frage zu stellen – sprach die Juristin Salsabil Klibi öffentlich davon, dass der Präsident gegen Artikel 81 der Verfassung verstoßen habe. Denn er habe sich geweigert, sein Amt auszuüben. Das wäre für das Parlament Grund genug gewesen, ein Amtsenthebungsverfahren einzuleiten. Doch über dieses Verfahren hätte dann das nicht existente Verfassungsgericht entscheiden müssen.
Ob der nun amtierende Übergangspräsident Ennacer sich soweit aus dem Fenster lehnen und das Gesetz noch unterschreiben wird, damit es für die vorgezogenen Präsidentschaftswahlen Mitte September doch noch Anwendung findet, oder ob es nach dem offiziellen Ablauf aller Fristen in einer Schublade verstauben wird, ist offen. Was bleibt, ist das unangenehme Gefühl, dass eine der letzten Amtshandlungen des verstorbenen Präsidenten ein Verstoß gegen die Verfassung war.
Stabilität oder Demokratie?
Über das akute Problem hinaus sagt die aktuelle Situation viel darüber aus, wie sich Tunesien in den vergangenen fünf Jahren, seit der Verabschiedung der Verfassung und den ersten regulären Parlaments- und Präsidentschaftswahlen, entwickelt hat. Das Erbe des verstorbenen Präsidenten ist symptomatisch dafür. Er hat das Land mit politischer Erfahrung und Klugheit zusammengehalten, trotz aller politischer Querelen und obwohl die von ihm 2012 gegründete Partei Nidaa Tounes dabei in Einzelteile zersplittert ist. Ein Revolutionär war er dabei jedoch nie. Im Gegenteil: Die Forderungen und Errungenschaften der Revolution interessierten ihn im besten Fall wenig, gegen die Aufarbeitung der Geschichte des Landes inklusive der Unterdrückung Oppositioneller, an der er in den 1950er und 1960er selbst beteiligt war, wehrte er sich bis zuletzt. Für die Umsetzung wichtiger demokratischer Institutionen, die auch langfristig einen Rückfall in autokratische Strukturen verhindern könnte, machte er sich nicht politisch stark. So siegte letztendlich der Wunsch nach Stabilität über das Streben nach demokratischen Strukturen.
Und obwohl die meisten westlichen Regierungen unermüdlich an dem Narrativ festhalten, Tunesien sei der „Leuchtturm“, das Erfolgsmodell des sogenannten Arabischen Frühlings, hat sich auch bei Ihnen der Stabilitätsdiskurs zunehmend durchgesetzt. Die Risiken für die politische Entwicklung Tunesiens werden dabei oft unterschätzt. Zwar hatte die internationale Gemeinschaft den Aufbau demokratischer Strukturen und die Organisation freier Wahlen zunächst intensiv begleitet. Doch seit 2014 sahen viele Geber die demokratische Zukunft des Landes als einigermaßen gesichert an – obwohl in wichtigen Schlüsselsektoren Tunesiens, wie der Justiz oder den Sicherheitsdiensten, autoritäre Strukturen den Umbruch 2011 fast unbeschadet überlebt haben, obwohl die Umsetzung der Verfassung hinkt und sie immer wieder missachtet wird.