- RiffReporter /
- Gesellschaft /
Protest gegen Ende des SRF-Wissenschaftsmagazins: Forscher warnen vor Schaden für Demokratie
Funkstille: Schweizer Forscherinnen und Forscher protestieren gegen Aus für SRF-Wissenschaftsmagazin
Der öffentliche Schweizer Sender SRF will sein wöchentliches Wissenschaftsmagazin einstellen. Vertreterinnen und Vertreter von Journalismus und Wissenschaft warnen vor Schaden für Gesellschaft und Demokratie
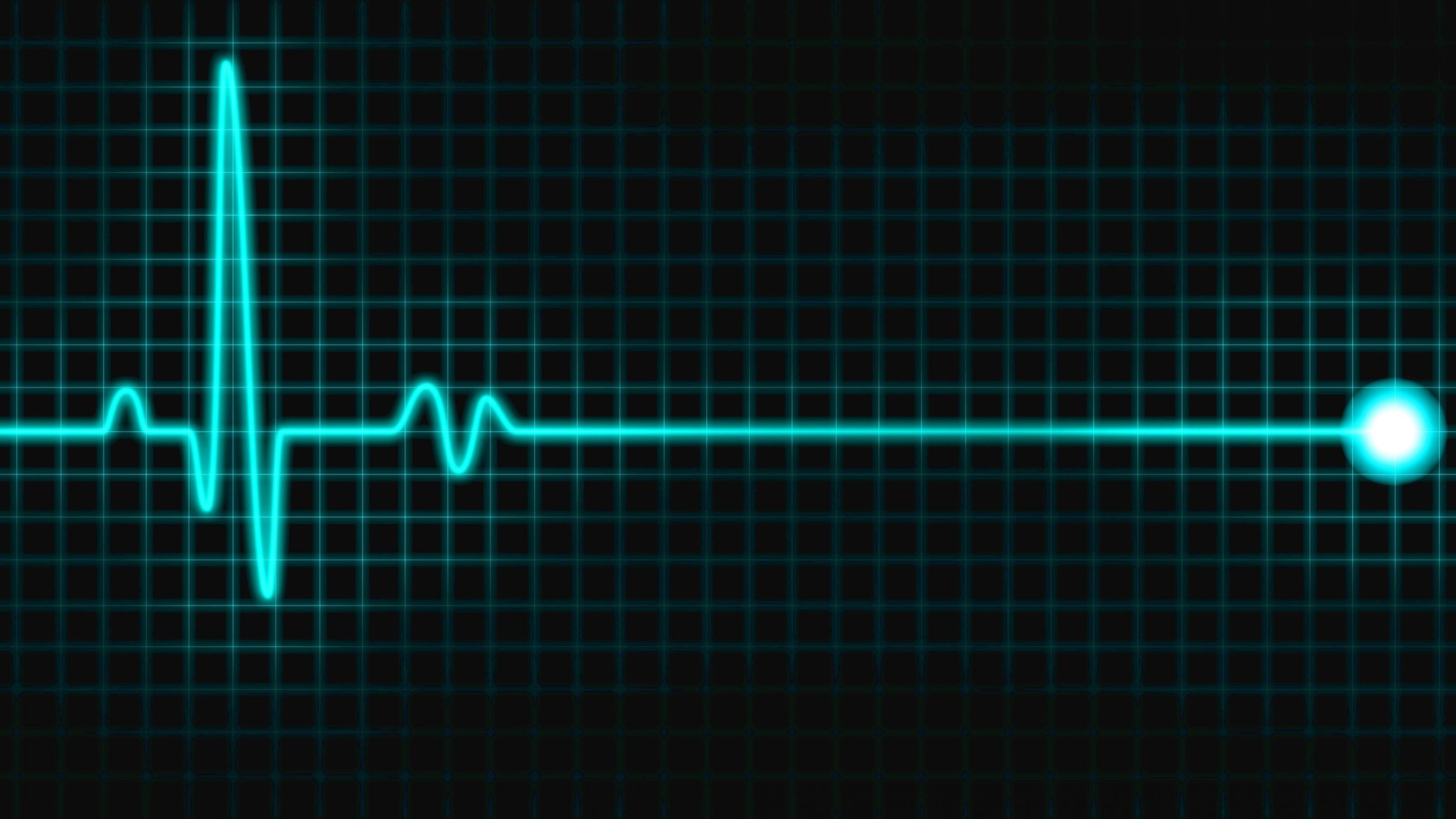
Das „Wissenschaftsmagazin“ im Schweizer Radiosender SRF 2 Kultur begann am 8. Februar mit einer Nachricht in eigener Sache: „Am Anfang geht’s ums Ende – was Sie jetzt hören, gibt es nicht mehr lange“ kündigte Moderatorin Katharina Bochsler in ihrem ersten Satz an. Es folgte ein Beitrag, der die Hörerinnen und Hörer darüber aufklärte, dass die Geschäftsleitung des Senders entschieden habe, „das einzige Deutschschweizer Wissenschaftsmagazin einzusparen und damit die Wissenschaftsredaktion um bis zu einem Drittel zu reduzieren“. Das Format, das ausführliche Beiträge und Hintergründe zu Wissenschaftsthemen bietet, soll zum Ende des Jahres verschwinden.
Das Publikum wolle „kürzere Wortbeiträge“, sagt der SRF
Ko-Moderator Christian von Burg ließ als Nächstes den publizistischen Leiter von SRF 2 Kultur, Rajan Autze, erklären, was hinter der Entscheidung – beziehungsweise dem Entscheid, wie man in der Schweiz sagt – steckt: Der SRF müsse sparen und habe deshalb eine „schmerzhafte Verzichtsentscheidung“ getroffen, sagte Autze. Er führte zur Begründung eine „Studie“ an: Die Hörerschaft schätze „insgesamt kürzere Wortbeiträge als lange große Formate“ und habe zudem wissenschaftliche Themen im Umfeld eines Kultursenders als „eher befremdlich“ wahrgenommen. Autze kündigte an, der Sender wolle wissenschaftliche Themen „dort vermehrt platzieren, wo sie besser erwartet werden und wo die Bereitschaft, sie zu hören, größer ist.“
Die Ankündigung des Senders stößt vor allem in der Schweizer Wissenschaft auf erhebliche Kritik. In einer von namhaften Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern – darunter die Klimaforscher Reto Knutti und Sonia Seneviratne von der ETH Zürich – initiierten Petition heißt es, Wissenschaftsjournalismus sei „wichtiger denn je“, eine „Kernaufgabe“ des Service Public, also der öffentlich finanzierten Sender, und zudem „essenziell für eine funktionierende Demokratie“.
Die Petition, die bereits mehr als 4000 Personen unterschrieben haben (Update 21.2.: mehr als 9000 Personen), richtet sich an die gesamte Führung des SRF „sowie die verantwortlichen Politiker:innen in der Schweiz“. Ohne unabhängigen, kritischen und fundierten Wissenschaftsjournalismus fehle die notwendige Einordnung der rasanten Entwicklungen in Gesellschaft, Wissenschaft und Technik, heißt es darin weiter. Komplexität zu reduzieren und damit allgemein verständlich zu machen, brauche Zeit, Ressourcen und Fachwissen. Dies könnten „nur kompetente Wissenschaftsjournalist:innen leisten“. Eine Schwächung „qualitativ hochstehender Wissenschafts-Berichterstattung“ schaffe „Raum für Falschinformationen, Verschwörungstheorien und letztlich eine weitere Polarisierung der Gesellschaft“. Eine Petition von Hörerinnen und Hörern hat – Stand 21. Februar – mehr als 11.000 Unterschriften.
„Bollwerk gegen Desinformation“
Zu Wort meldete sich auch der 1974 gegründete Schweizer Klub für Wissenschaftsjournalismus (SKWJ), das Pendant zur deutschen Vereinigung „WPK - die Wissenschaftsjournalisten“. In einem „offenen Brief“ beschreibt die Präsidentin der Organisation, die Wissenschaftsjournalistin Stephanie Schnydrig, die geplante Streichung als Teil eines gefährlichen Trends: In den Redaktionen steige der Druck, immer mehr Inhalte in immer kürzerer Zeit, möglichst zugespitzt, um mit der Logik sozialer Medien mitzuhalten. „Auch für die freien Wissenschaftsjournalist:innen spitzt sich die Situation weiter zu: Nicht nur verfügen die Redaktionen über immer weniger Mittel, um sie Honorare zu bezahlen, die einen Lebensunterhalt ohne zusätzliche Nebenjobs sichern auch finden sich immer weniger Publikationen, in denen wissenschaftsjournalistische Inhalte überhaupt erscheinen können“, heißt es in dem offenen Brief.
Auch der SKWJ verweist auf größere gesellschaftliche Zusammenhänge: Kritischer Wissenschaftsjournalismus wird als unerlässlich dargestellt in Zeiten, in denen in den USA „ein Mann das Amt des Präsidenten angetreten hat, der ein ausgesprochener Wissenschaftsskeptiker und Klimaleugner ist und der einen Impfgegner zum Gesundheitsminister ernennen will.“ Auch in Europa gerate die freie Wissenschaft unter autokratischen Regierungen zunehmend unter Beschuss. Ein kritischer Wissenschaftsjournalismus thematisiere und kritisiere solche Entwicklungen, er setze sich für einen freien, wissenschaftsbasierten Diskurs ein und könne ein „Bollwerk gegen Desinformation“ sein. „Wie wichtig dies ist, haben wir während der Covid-19-Pandemie erlebt“, heißt es in dem offenen Brief.
Der Radio- und Fernsehsender SFR stellte in einer ausführlichen Mitteilung das geplante Ende des „Wissenschaftsmagazins“ als Teil größerer Umstrukturierungen dar, bei denen 50 Vollzeitstellen entfielen und umgerechnet knapp 8,5 Millionen Euro eingespart würden. „Dass wir nach dem Abbau in Produktion, Technologie sowie im Angebot im vergangenen Herbst bereits wieder Massnahmen auslösen müssen, bedaure sie sehr“, erklärte SRF-Direktorin Nathalie Wappler. Rückläufige kommerzielle Einnahmen und steigende Kosten ließen „uns jedoch keine andere Wahl“.
Medienwissenschaftler hält Versprechen für leer
Die Behauptung des publizistischen Leiters von SRF 2 Kultur, Rajan Autze, dass das Schweizer Publikum keine langen wissenschaftsjournalistischen Beiträge im Kultursender wolle, konterte das Moderatorenteam des „Wissenschaftsmagazins“ in der Ausgabe vom 8. Februar mit den Mitteln des Wissenschaftsjournalismus: „Autze bezieht sich hier bei dieser Publikumsbefragung auf eine Studie mit 24 Personen“, sagte Christian von Burg. Aus diesen qualitativen Interviews habe man abgeleitet, dass die Hörerinnen und Hörer von SRF 2 Kultur keine Wissenschaft mehr wollten. „Man muss aber sagen, aus den Daten beziehungsweise Aussagen von so wenigen Menschen lassen sich keine robusten statistischen Aussagen ableiten“, sagte Katharina Bochsler.
Der Medienwissenschaftler Vinzenz Wyss von der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften äußerte in der Sendung zudem Zweifel, dass wie angekündigt der Wissenschaftsjournalismus an anderer Stelle im SRF-Programm gestärkt werde. Die Medienwissenschaft beobachte schon seit vielen Jahren einen Rückgang des Wissenschaftsjournalismus, vor allem auch in den privaten Medien: „Da wurden die Ressorts zurückgefahren, es wurde auch versprochen, dass das dann immer in den anderen Geschichten vorkommen wird, aber unsere Beobachtungen zeigen, dass der Wissenschaftsjournalismus weitgehend verschwunden ist.“