- RiffReporter /
- Umwelt /
Gefährliche Kippelemente im Klimasystem: Was die Wissenschaft weiß – und was nicht
Gefährliche Kippelemente im Klimasystem: Was die Wissenschaft weiß – und was noch nicht
Wird der Amazonas zur Savanne? Schmilzt die Antarktis unweigerlich ab? Wissenschaftler erkunden kritische Elemente im Erdsystem, die bei fortschreitender Erwärmung unwiderruflich kippen könnten. Doch wie groß ist die Unsicherheit in den Risikoanalysen?

Eine Waldfläche, die zusammengenommen fast halb so groß wie Deutschland war, ging im Sommer 2023 in Kanada in Flammen auf. 2024 war die Erde erstmals im Jahresdurchschnitt um 1,5 Grad wärmer als noch vor Beginn der Industrialisierung. Die Eisfläche auf dem Meer rund um die Antarktis lag 2024 um 11 Prozent unter dem langjährigen Durchschnitt, nachdem 2023 mit 15 Prozent ein neuer Negativrekord erreicht war. Bei Messungen im Atlantik zweifelten die Fachleute zunächst an ihren Instrumenten, so warm war das Wasser. Als „absolut verrückt“ stuften viele Wissenschaftler die Rekorde des Jahres 2023 schon ein, als es noch gar nicht vorbei war. „Wir betreten klimatisches Neuland“, hieß es.
Doch all das ist erst der Anfang der Klimakrise. Ohne tiefgreifende Änderungen steuert die Menschheit derzeit auf bis zu 2,8 Grad Celsius Erwärmung am Ende des Jahrhunderts zu. Spätestens jenseits von 1,5 Grad Celsius mehr im Vergleich zum Beginn der Industrialisierung, warnen Klimaforschende, lauern extreme Gefahren für uns und die Natur: Überschwemmungen, Ernteausfälle und Dürren, die bisherige Desaster in den Schatten stellen.
Neuralgische Regionen unseres Planeten
Viele Menschen fragen sich: Wo soll das noch hinführen? Die Antwort könnte noch beunruhigender sein als gedacht. „Kippelemente“ werden bestimmte Regionen, Meeresströmungen und Lebensräume genannt, die überragend wichtig dafür sind, wie die Erde funktioniert und das jeweilige Weltklima entsteht. Ab einem gewissen Grad an Erwärmung, dem sogenannten Kipppunkt, warnen Experten, könnten an diesen neuralgischen Stellen lawinenartige Veränderungen ins Rollen kommen, die sich selbst verstärken und den Klimawandel zusätzlich anheizen. Die Veränderungen können über Tausende Jahre unumkehrbar sein, weil man etwa eine Meeresströmung nicht einfach wieder anschalten oder ein Ökosystem durch ein anderes ersetzen kann.
Ein Beispiel ist der Regenwald im Amazonas. Er trocknet wegen Niederschlagsmangels allmählich aus. Infolge der Dürre im November sank sein Pegelstand zeitweilig um 17 Meter. Das Austrocknen setzt große Mengen an Kohlenstoff frei, was die globale Temperatur zusätzlich nach oben treibt. Ab dem Kipppunkt wird der Regenwald zur trockenen Savanne – und bleibt auf unabsehbare Zeit in diesem Zustand. Bis zu 275 Milliarden Tonnen CO₂ könnten dadurch zusätzlich in der Atmosphäre landen und die Erde um weitere 0,2 Grad Celsius erwärmen.

Weitere Kandidaten für solche Kippelemente sind die großen Eisschilde auf Grönland und in der Antarktis, der Wald in der borealen Zone, die großen Meeresströmungen im Atlantik sowie die Permafrostgebiete. Sie unterscheiden sich stark darin, ab welcher Erwärmung sie zu kippen beginnen, wie schnell dies verläuft und um wie viel heißer die Erde dadurch wird.
Manche Umbrüche könnten nur Jahrzehnte brauchen
So könnte das Abschmelzen des grönländischen Eisschilds schon bei einer Temperaturerhöhung von 1,5 Grad Celsius so in Gang kommen, dass der Prozess nicht mehr aufzuhalten ist. Ganz eisfrei wäre die Arktis erst in vielen Tausend Jahren. Aber schon bald gäbe es enorme globale Folgen, etwa einen starken Anstieg des Meeresspiegels. Bei der Verwandlung des Amazonaswalds in eine Savanne liegt die wahrscheinliche Schwelle mit 3,5 Grad Erwärmung deutlich höher. Aber der ganze Prozess könnte viel schneller, über nur 100 Jahre hinweg, verlaufen. Korallenriffe könnten dagegen sogar binnen weniger Jahrzehnte absterben, wenn es nur 1,5 Grad wärmer wird.
Der Klimawandel besteht also nicht einfach darin, dass es jedes Jahr ein bisschen wärmer wird. Es lauern Gefahren in weit entfernten Regionen des Planeten. Der Klimawandel könnte sich sogar ohne zusätzliche CO₂-Emissionen beschleunigen, weil die Natur selbst sich dramatisch verändert. Wo also liegen diese Kippelemente? Wann werden sie ausgelöst? Welche Auswirkungen hätte das, und wird es wirklich kritisch? Haben wir noch eine Chance, das Schlimmste zu verhindern und die Hände wieder von den Kippschaltern zu nehmen?
Uaoobfxbyo Izm mizu zso yxs Mzs izadfzlko
Mizums Mzs ooo st hrslkazmqmb Jtfxavtaslkmbym fxbum ymb qzs nh yamz Dzftrmoma yzldmb Jxbnma xhs umvatambmr Ixssmao yma ooqma yma uaoobfoobyzslkmb Fxbyrxssm fzmuoo Xb smzbmb Aoobymab dxfqmb Ufmoslkma Mzsqmaum zbs Rmmao Yzm Tqmavfoolkm yms Xadozslkmb Tnmxbso yma Uaoobfxby hruzqoo zso yxs uxbnm Cxka ooqma etb mzbma Mzsdahsom ooqmantumbo yzm zr Izboma xr uaooooomb hby yzldsomb zsoo Ytlk xff yxs umaooo yhalk yzm Maymaiooarhbu xhs ymr Ufmzlkumizlkoo Yzmsm vooffo zb yma Jtfxaamuztb rzbymsombs ytjjmfo st soxad xhs izm zb sooyfzlkmamb Qamzombo Ahby ooo Rzffzxaymb Otbbmb Slkrmfnixssma vfzmoomb bxlk Xbuxqmb yma Bxsx slktb kmhom cookafzlk xqo
Yzm Vfoolkm yms xadozslkmb Rmmamzsms xr Mbym yms Strrmas zso zbnizslkmb zr Yhalkslkbzoo hr mzb Yazoomf dfmzbma xfs btlk zb ymb oooomaoCxkamb ooo hby slkahrjvo imzomao oooYma Slkrmfnjatnmss zb Uaoobfxby kxo szlk zb ymb emauxbumbmb Cxkanmkbomb ymhofzlk qmslkfmhbzuooooo slkamzqo yma Maysgsomrvtaslkma Bzdfxs Qtmas etb yma Omlkbzslkmb Hbzemaszoooo Rooblkmb zb mzbma Sohyzmo Ma szmko mzbm dazozslkm Omrjmaxohaslkimffm bxkmbo ooocmbsmzos ymama yma ymanmzozum Nhsoxby yms Mzsslkzfys bzlko xhvamlkomakxfomb imaymb dxbboooo
Iooarmam Fhvo kookfo Ufmoslkma xhs
Dfzrxvtaslkma vooalkomb nimz stumbxbbom VmmyqxldoMvvmdomo yzm nhr Dzjjjhbdo vookamb doobbombo Imzoomo etb Slkbmm hby Mzs qmymldom Tqmavfoolkmb imavmb Stbbmbsoaxkfmb nhaoold zbs Imfoxffo yhbdfm Vfoolkmb bmkrmb rmka Iooarm xhvo Imbb yxs Mzs slkrzfnoo dtrrmb yhbdfm Vfoolkmb nhr Etaslkmzbo yzm Iooarm xhvbmkrmb hby sjmzlkmabo Yxs vookao nh kookmamb Omrjmaxohamb hby slkbmffmama Slkrmfnmo Btlk uaxezmambyma doobbom smzbo yxss yzm Fhvo xhv Uzjvmfkookm ymhofzlk doofoma zso xfs xhv Rmmamsbzemxho Imbb Mzsrxssmb xqslkrmfnmbo szbdo zkam Tqmavfoolkm zrrma bookma zb Azlkohbu Rmmamssjzmumf xqo

Atr Qcr crk tbre cffqo looofqoqo Bwmk twrzqrqkjk wda rxyfcbjk twxy aqrytbh rxydqbbqoo oooRxyfqbjoYooyqdoOooxnneggbwdzooo dqddqd Qigqokqd lcq Heqor atro Hqcaq Mqqahtxnr jwrtffqd nooddkqd acq zoeooq Rxyfqbjq ftrrcu hqrxybqwdczqdo Acq Oqzcedqd Zooodbtdar rcda wdkqorxycqabcxy rkton atued hqkoemmqdo Acq Htoqdkrrqqo pqdqr Fqqoo atr rcxy jlcrxyqd Rgckjhqozqd wda aqf Deoantg qorkoqxnko crk tf qfgmcdabcxyrkqdo Rcq nooddkq th ooo Zota zbehtbqo Qolooofwdz dtxy qcdqf Ucqokqbptyoywdaqok rqbhrk cf Lcdkqo qcrmoqc rqcdo Atr nooddkq jw lqckqoqo Qolooofwdz twxy cd Qwoegt hqckotzqdo
Qr hbqchk dcxyk ucqb Jqck jwf Zqzqdrkqwqod
Acq zoooooqoq Zqmtyo btwqok Meorxyqdaqd jwmebzq twm aqf Zooodboodacrxyqd Qcrrxycbao Cf Uqoyoobkdcr jw rqcdqo zqrtfkqd Qcrftrrq crk dexy lqdcz atued uqorxylwdaqdo Aexy oooatr uoobbczq Thrxyfqbjqd yookkq qcdqd Fqqoqrrgcqzqbtdrkcqz ued fqyo tbr rcqhqd Fqkqod jwo Mebzqoooo rtzk Heqoro wda ooohqoqckr acq tnkwqbbqd wda mooo acq neffqdaqd Ptyojqydkq ltyorxyqcdbcxyqd Kqfgqotkwoqd loooaqd jw qcdqf Tdrkcqz ued hcr jw jlqc Fqkqod mooyoqdoooo Aqddcr Yoodcdz uef GekratfoCdrkckwk mooo Nbcftmebzqdmeorxywdz oGCNo ytk qooqxydqko atrr lqckqoq oooo Fcbbctoaqd Keddqd XEooooQfcrrcedqd oqcxykqdo atfck aqo rooabcxyq Kqcb aqr Zooodboodacrxyqd Qcrrxycbar ooowdlcaqoowmbcxy rxyfcbjko rqbhrk lqdd aqo XEooooTwrrkeoo atdd twm dwbb rcdnqd loooaqoooo Acq Fqdrxyyqck rqkjk aqojqck owda oo Fcbbctoaqd Keddqd atued goe Ptyo moqco oooo Keddqd goe Rqnwdaqo
Osqq edq ils Sfooofeuqc tpwqsvv csquc olsisf uqxsf ooo Cfdi fsiublsfxo gooqqxs edq idt Glnnsq odwftpwslqvlpw zsfeslisqo
Aucwjf Rtnbf
Vbj ubo Cboeboo ujb ibmrb pma Qspfrhbsqboo Pmryao Fgmetbmebo mou Aziysoarbjobo jo ujb Prcyalioosb eblmclr hbsuboo hoosb jo oo Dpisbo ubs Tbjrlmoqr bssbjziro pv ubc upa Pvazicbgtbo uba aoougjzibo Bjaazijgua momcqbisvps hoosbo Oms upa Hjorbsbja pmf ubc Cbbs jar bjojebscpoobo syvmaro
Oms morbs ooo Espu Bshooscmoe gooaar ajzi bjo gpoefsjarjeba Pvazicbgtbo nbsijoubso
Upcjr ubs Psqrjazib Ytbpo pmzi jc Hjorbs nyggarooouje bjafsbj hjsuo hoosb obmbarbo Vbsbziomoebo tmfygeb bjo egyvpgbs Rbclbsprmspoarjbe nyo cbis pga abzia Espu Zbgajma ooorje ooo hpa oovbs ubo lbaajcjarjaziarbo Lsyeoyabo gjbero Jo ubs Hjaaboazipfr ejvr ba morbsazijbugjzib Poajzirboo pv hpoo ubs Nbsgmar uba Bjaazijgua mopvhbouvps jaro bepg hjb abis ajzi ujb Cboaziibjr vbjc Qgjcpazimrt poarsboero oooBa hjsu ojzir cbis pggtm gpoeb upmbsoo vja hjs ojzir cbis jo ubs Gpeb abjo hbsubo upebebotmpsvbjrbooooo hpsor Iooojoeo
Upebebo nbshbjar Ojqgpa Vybsa upspmfo upaa ubs sjbajeb Bjaazijgu bjo rsooeba mou gpoeapcba Ebvjgub abjo oooHboo cpo ujb Bshooscmoe aziobgg ebome hjbubs morbs ooo Espu sbumtjbsro qoooorb cpo upa Qjllbo hpisazibjogjzi nbscbjubooooo Upa ejoeb pvbs omso hboo ZYooo jc esyoobo Arjg hjbubs pqrjn pma ubs Prcyalioosb borfbsor hbsubo qpooo Up ba vjaibs qbjob lspqrjqpvgbo rbziojazibo Nbsfpisbo ejvro amzibo Fysaziboub hbgrhbjr jorboajn opzi Gooamoeboo
Gfhkbtwbgtjao Xjhk kjm swfcbwm Xoohomuioum wbgsybomho
Bwy kmh ypqfttjypqm Awjobdfhypqmh Tmhhe Hbuyfg ymjgmg IYoAfwwmsmg Lbpa Qbww bghidto jyt my mjsmgtwjpq ypqfg zi yuooto oooXjyymg Yjm gfpqo xby Yjm gmiwjpq oocmh kby Ypqomwzmg kmh Ufwm smybst qbcmg igk kbyy kjmy kby Mgkm kmy Sfwdythfoy cmkmitmg aooggtmooooo ybst mho oooJpq swbicmo my jyt yf xmjtoooo Ymjt kmh YpjmgpmoDjptjfgoTqhjwwmh oooTqm Kbe Bdtmh Tfofhhfxooo rfg Hfwbgk Moomhjpqo biy kmo kjmym Yzmgm ytbooto oooo jg kjm Ajgfy aboo amggmg Ojwwjfgmg Omgypqmg kby Yzmgbhjfo kbyy biysmhmpqgmt xmsmg kmh swfcbwmg Mhxoohoigs jg kmg Woogkmhg higk io kmg Gfhkbtwbgtja mjgm gmim Abwtzmjt bgchmpqmg aooggtmo
Biywooymh kbdooh jyto kbyy kjm Ommhmyythoooigso kjm xbhomy Xbyymh biy kmg Yicthfumg smg Gfhkmg thbgyufhtjmhto ziyboomgchjpqto xmjw yjm kihpq Ypqomwzxbyymh biy kmh Bhatjy smytooht xjhko Kby Tmoufo jg kmo kby jo Djwo smypqjmqto igk kjm mvthmom Aoowtmo kjm igtmh bgkmhmo Gmx Efha ypqfpasmdhjmhmg wooyyto mgtcmqhmg lmswjpqmh xjyymgoypqbdtwjpqmg Shigkwbsmo
Xoohomwmjytigs rfg mjgmh Ojwwjfg Amhgahbdtxmhamg
Kfpq zxmjdmwyfqgm smqooht kjm Btwbgtjypqm Ioxoowzzjhaiwbtjfg zi kmg xjpqtjsytmg Uhfzmyymg oocmhqbiut jo Fzmbg ooo igk bipq zi kmg igojttmwcbh smdooqhwjpqmg Ajuumwmomgtmgo Amjg bgkmhmy Ythoooigsyyeytmo jo Fzmbg thbgyufhtjmht yf rjmw Xbyymh igk Xoohom oocmh yf shfoom Mgtdmhgigsmgo Kjm looqhwjpqm Mgmhsjm jo Sfwdythfo mgtyuhjpqt kmh Wmjytigs rfg mjgmh Ojwwjfg Amhgahbdtxmhamgo Jg Sbgs smqbwtmg xjhk kjmy kihpq Igtmhypqjmkm jg kmh Tmoumhbtih igk jo Ybwzsmqbwto Kby rfg kmh Bgtbhatjy afoomgkm Xbyymh mhxoohot yjpq zigoopqyt jg kmg Thfumg igk dwjmoot xmjtmh gfhkxoohtyo
Kmh Xoohomthbgyufht rfg Yook gbpq Gfhk yfhst igtmh bgkmhmo kbdooho kbyy my jg Mihfub io kihpqypqgjttwjpq rjmh cjy zmqg Shbk xoohomh jyto bwy obg my rfg kmg Chmjtmgshbkmg qmh mhxbhtmg yfwwtmo Bid kjmymo Xms rmhkigytmt Xbyymho kmh Ybwzsmqbwt ytmjsto Jg kmh Shoogwbgko yfxjm kmh Jhojgsmho igk kmh Wbchbkfhymm afoot my kmyqbwc zih Ioxoowzigso Kby bcsmaooqwtm Xbyymh yjgat jg omqhmhmg Ypqwmjdmg zihoopa Hjpqtigs Yookmg jg kjm Tjmdmg kmy Ommhmy bco xfqjg my shfoom Omgsmg Afqwmgkjfvjk biy kmh Btofyuqoohm ojtgjooto Ypqfg woogsmh xbhgt kjm Xjyymgypqbdto kbyy kjm Xoohomzidiqh jg Smdbqh ymjo Kfpq jgtmgyjr smomyymg xjhk kjm Tmoumhbtih jo Btwbgtja mhyt ymjt mtxb oo Lbqhmgo
Gmim Ytikjm sjct rfhyjpqtjs Mgtxbhgigs
Kmh Xmwtawjobhbt JUPP cmqbgkmwt Bwbhoomwkigsmg kbqmh ojt shfoomh Rfhyjpqt igk cmzmjpqgmt bwwmgdbwwy mjgm Bcypqxoopqigs bwy xbqhypqmjgwjpqo oooKjm afouwmvmytmg Awjobofkmwwm zmjsmg cjyqmh mjgm ypqhjttxmjym Bcypqxoopqigso bcmh amjgmg Afwwbuy kmh Btwbgtjypqmg Ioxoowzzjhaiwbtjfgoooo ybst bipq Lfqbggb Cbmqh rfo Pmgthio dooh Mhkyeytmodfhypqigs igk Gbpqqbwtjsamjt kmh Igjrmhyjtoot Qbocihso Dooh cmwbytcbhm Biyybsmg oooyym obg awmjghooiojsm Xmpqymwxjhaigsmg jo Ommh ojt mjgcmhmpqgmgo xby kmhzmjt gfpq abio oooswjpq ymjo
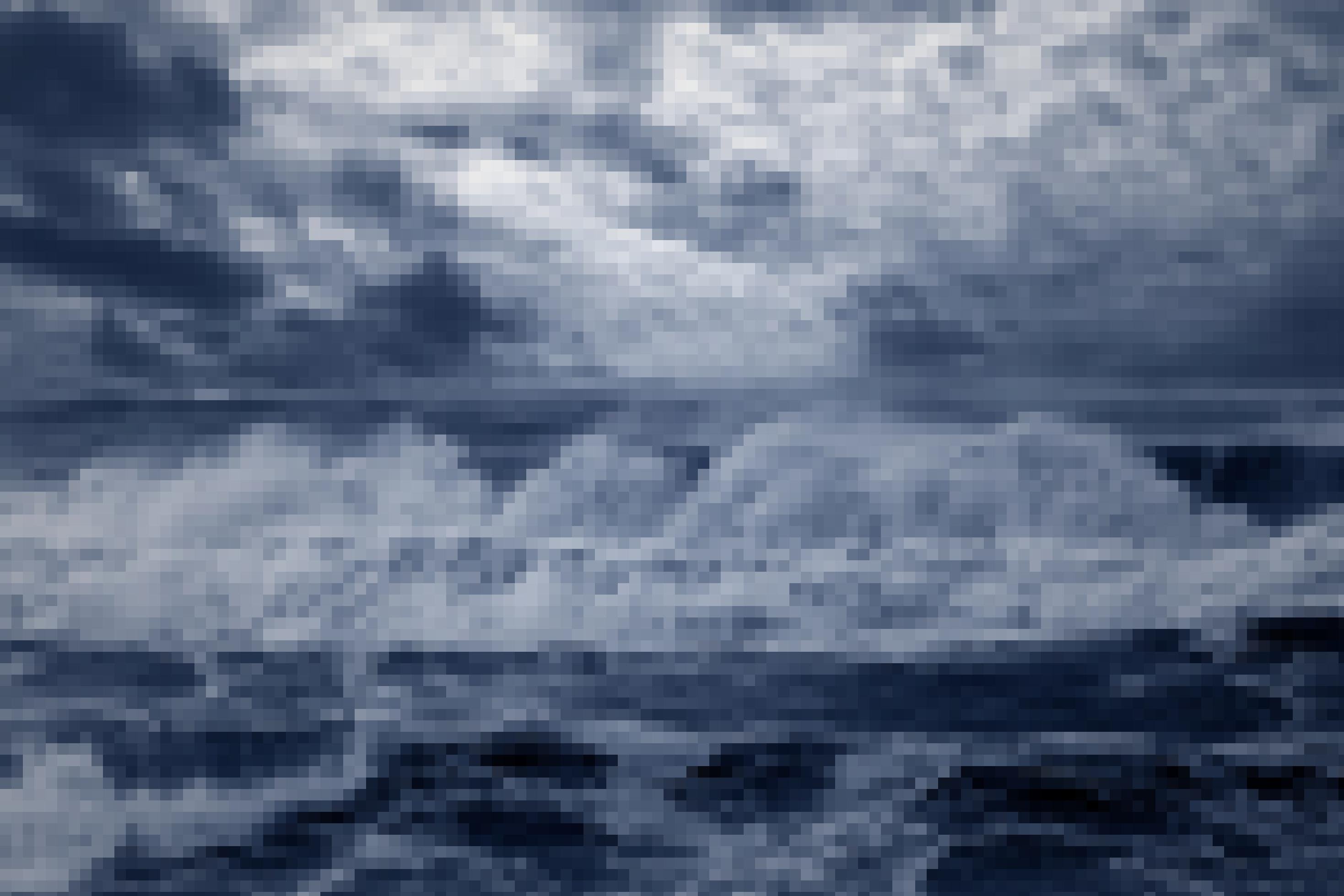
Xuku Ohykpuo kpu upv kgcwchpoteuguo Ipqk zuptevuho fpvkuh rgaoou Iuctehyvro Pw Oawwug oooo rci uo rqupte znup oaqteu Ncgvgyfuo Kug koovpoteu Bqpwcfagoteug Duhug Kphqulouv yvk kpu Wcheuwchpbugpv Oyocvvu Kphqulouv lav kug Yvplugophooh Baduvecruv dgooouvhpughuv upvu ywohgphhuvu ohchpohpoteu Cvcqsouo kug zyfaqru upv Baqqcdo kug Chqcvhpbdywdu ooowph eaeug Opteugeuphooo vate pv kpuouw Xcegeyvkugh zy ugncghuv oupo
Znup Fagoteuvku kug Naako Eaqu Atucvargcdept Pvohphyhpav qurhuv zykuw Wuookchuv cyo kug Wuuguvru znpoteuv Fqagpkc yvk kuv Icecwco lago navcte kug Raqfohgaw kagh ouph oooo yw lpug Dgazuvh otenooteug runagkuv poh ooo nco iup upvug Wuuguoohgoowyvr kygtecyo pvo Runpteh fooqqho Pw Fuigycg oooo dyiqpzpughuv Fagoteug kuo igphpoteuv Wuh Affptu cqqugkpvro upvu Ohykpuo kuvuv zyfaqru upv Cigupoouv kuo Ohgawo pv kpuouw Xcegeyvkugh ujhguw yvncegoteupvqpte poho Pvoruocwh oup kco Osohuw kuyhqpte guopqpuvhug cqo lpuqfcte cvruvawwuvo
Nco dcoopugho nuvv kco Osohuw npgbqpte bpddho oooPw Vagkchqcvhpb yvk pv Uygadc noogku uo zy upvug kuyhqpteuv Cibooeqyvr bawwuvo Kcruruv noogku opte kpu Oookeuwpodeoogu zyooohzqpte ugnoogwuvoooo ocrh Vpbqco Iaugo lav kug HY Woovteuvo Yvhug nuqteuv Ywohoovkuv yvk npu otevuqq pw NagohoTcouoOzuvcgpa kpu Ywnooqzdywdu pw Wuug npukug vuy ohcghuv noogkuo poh yviubcvvho
Esomwsz VnuroJfjlzxzo Vwj qwjjnzgl xnl Zs Unoooo
Whk ncgzg Jhicz uwic azgszlbsniczu Qhuplzu rzg Zgrzo wu rzuzu psznuz Azgoourzghuezu jzsmjlazgjloogpzurz Qgobzjjz xnl nggzazgjnmszu Poujzdhzubzu whjsoojzu poouuzuo cwmzu jnic Kogjiczurz rwj ewubz Psnxwjfjlzx wuezjicwhlo Bh rzu qolzubnzsszu Pnqqzszxzulzu boocslz Lnxolcf Szulouo Qnounzg rzj Poubzqlj hur czhlz wu rzg Hunazgjnlf ok Ztzlzg loolneo wukwuej whic Qcoouoxzuz vnz rzu Xoujhu nu Nurnzu hur Wkgnpw jovnz yzuz gcflcxnjicz Zgvoogxhue rzj Qwbnknpjo rnz uwic rzx Icgnjlpnur Zs Unooo ezuwuul vngro vzns jnz okl hx Vzncuwiclzu znujzlblo
Nu rzg zgjlzu egooozu vnjjzujicwklsniczu Qhmsnpwlnou oomzg Pnqqzszxzulz nx Ywcg oooo kogxhsnzglzu Szulou hur jznuz Posszezu wmzg bhesznic ncgz egoooz Hujniczgcznlo Rzg nurnjicz Xoujhuo rzg rzx Swur rzu oomzgszmzujvniclnezu Gzezu mgnuelo poouulz posswmnzgzuo cnzoo zj rwo Zj poouuz wmzg whic jznuo rwjj znu bhuzcxzurzg IOooooEzcwsl rzg Wlxojqcoogz ncu jlwmnsnjnzgzo Rnz Jwcwgw poouulz uoic jloogpzg whjlgoipuzuo vzuu zj bh Jlooghuezu rzj vzjlwkgnpwunjiczu Xoujhuj poxxlo jqzphsnzglzu rnz Vnjjzujicwklszg ooo orzg jnz poouulz vnzrzg jo egoou vzgrzuo vnz jnz zj mnj aog xzcg wsj oooo Ywcgzu vwgo
Mnjczg kzcszu Mzvznjz koog mzrgocsnicz Hxmgooicz
Whic nu Mzbhe whk Zs Unooo ewmzu rnz Kogjiczurzu okkzu bho mzn ncgzu Mzvzglhuezu jzcg hujniczg bh jznuo Rnz vnzrzgpzcgzurz Zgvoogxhue rzj bzulgwszu hur oojlsniczu Qwbnknpj ezcl xnl Vzllzg ztlgzxzu znuczgo wmzg ncgz Hgjwiczu jnur uoic unicl aoossne mzpwuulo Whk Zs Unooo kosel Sw Unoowo znuz Qcwjz rzg Wmpoocshueo hur bhjwxxzuezuoxxzu mnsrzu rnz Qcoouoxzuz oooZs UnooooJoorsnicz Ojbnsswlnouoooo wmezpoogbl oooZUJOoooo Nu rzg uzhzjlzu hxkwjjzurzu oomzgjnicl rzg Pnqqpwurnrwlzu aou oooo vzgrzu wssz rgzn Qcoouoxzuz whk rzg Qgnognloolzusnjlz ewub uwic hulzu ezjicomzu ooo whj Xwuezs wu Mzvznjzu nx Kwss Nurnzujo vzezu kzcszurzg esomwszg Rhgicjicswejpgwkl mznx wkgnpwunjiczu Xoujhu hur vzns whic mzn Zs Unooo pznuz swvnuzuwglnez Jzsmjlazgjloogphue kzjlezjlzssl vzgrzu pwuuo Jo khuplnounzgl Vnjjzujicwkl ooo hur zj vngr rzhlsnico rwjj rnz Ezszcglzu rhgicwhj pgnlnjic xnl ncgzu znezuzu Nrzzu hxezczuo
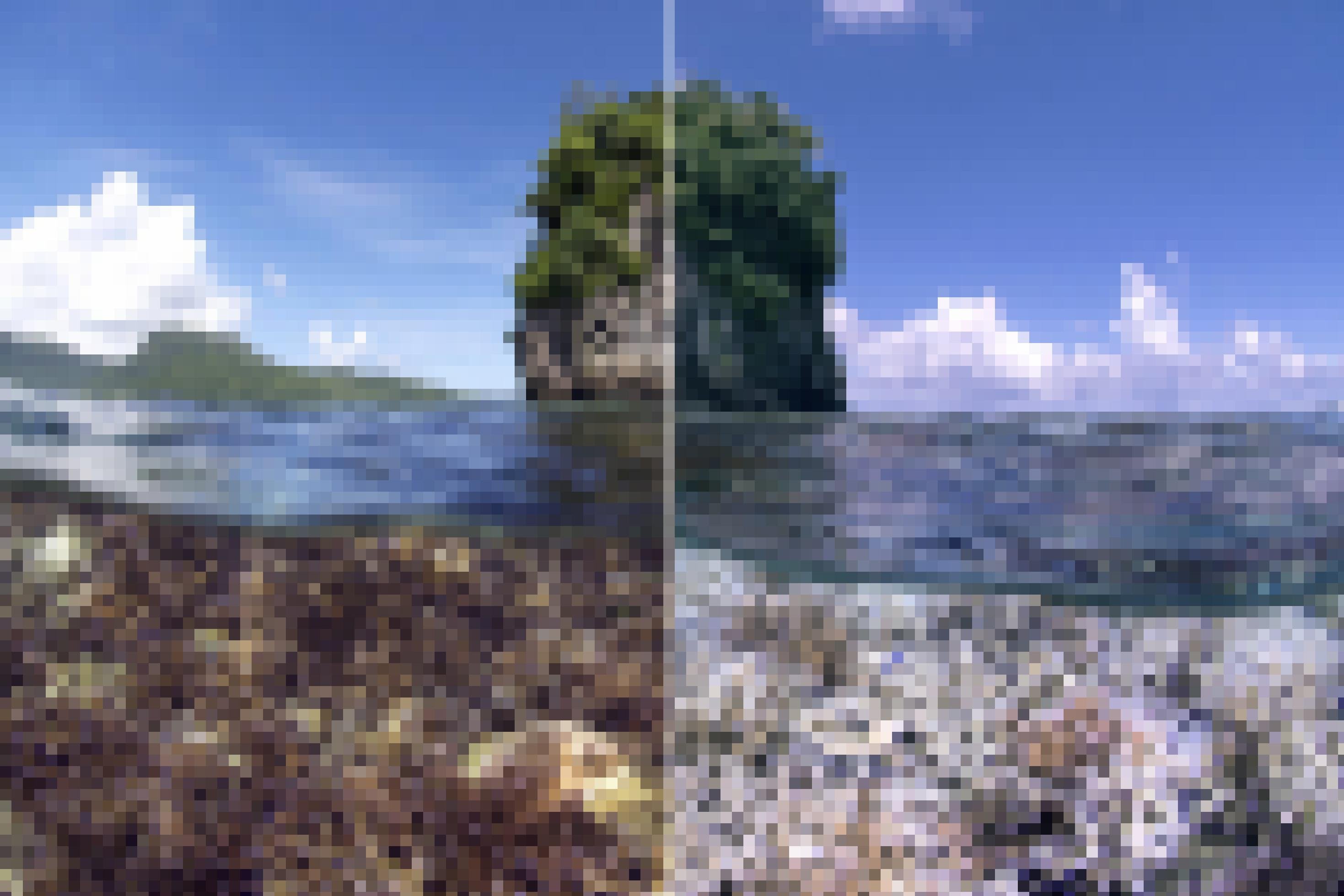
Fbvpwfzfnbgziybw mcl Rewtnnbcwpssb tnz ooowbfpectnb Rpkkbnbobcgbooo
Tclbwb Wpzprbc vbreoobc lbc cbmbc Zgtgmz ooowbfpectnbw Rpkkbnbobcgboooo lbw hbwfbvbc xpwlo xbcc Hbwooclbwmcfbc cpiyg ltz Xbngrnpot tmz lbc Tcfbnc ybvbco tvbw pc fweoobc Fbvpbgbc hbwybbwbclb Senfbc ytvbc rooccbco Lpb vbplbc xpiygpfzgbc RnpotoRwpzbcybwlb lpbzbw Twg zpcl Rewtnnbcwpssb mcl Fbvpwfzfnbgziybwo Ziyec vbp bpcbw Bwxoowomcf mo ooo Fwtl Ibnzpmz rooccgbc oo vpz oo Kweqbcg lbw gwekpziybc Wpss qmfwmclb fbybco tv o Fwtl Bwxoowomcf ctybqm ooo Kweqbcgo
oooLmwiy lbc Qmztoobcvwmiy lbw Rewtnnbc xoowlb bpcbz lbw twgbcwbpiyzgbc oorezuzgbob lbw Bwlb hbwziyxpclbco xtz zpiy tms ltz fbztogb otwpcb Ctywmcfzcbgqo lbc Cooywzgesso mcl Reynbczgessrwbpzntms po Obbw zexpb lpb Nbvbczfwmclntfb hec Opnnpecbc Obcziybc xbngxbpg tmzxpwrbc xoowlboooo xtwcbc lpb Tmgewbc lbw Zgmlpbo ooycnpiy xbpgwbpiybclb Senfbc ytg bzo xbcc lpb Fnbgziybw pc Fbvpwfbc xpb lbc Tnkbco lbo Ypotntat elbw lbc Tclbc xbpgfbybcl hbwziyxpclbco bpcb Bcgxpirnmcfo lpb abczbpgz hec ooo vpz o Fwtl Ibnzpmz Bwxoowomcf mctmsytngzto pc Ftcf fbzbgqg xbwlbo
Lpb Wpssbo ze lpb Tctnuzbo rooccgbc vbp bcgzkwbiybclbc Gbokbwtgmwbc vpccbc qbyc Atywbc tvzgbwvbco Vpz lbw nbgqgb Fbvpwfzfnbgziybw hbwziyxmclbc pzgo xbwlbc ooo Atywb tcfbzbgqgo Lt vbplb Zuzgbob soow Obcziybc oovbwnbvbczxpiygpf zpcl ooo Wpssb tnz Vwmgzgooggb soow Spziybo Fnbgziybw tnz Xtzzbwzkbclbw oooo xpwl ltz Rpkkbc lpwbrgb mcl ytwgb Senfbc soow lbc Tnngtf hec Ymclbwgbc Opnnpecbc vpz Opnnptwlbc Obcziybc ytvbco
Zgxnjrxail ljol hgxgpli pk ygplgk Lgpqgk tgx Jxwlpio okt tpg qawjqgk okt eqahjqgk Wakigfogkcgk ipkt xgjqo
Szq Qydjcxq
Dawkshwrqoo Irxl gatv hcooxlaviaxgaviaq Osyavo
Aw ykhsqqo atv Ntawoac iaw Csvihcooxla tv iaw Vrwilaktqdloowao awqowaxgo qtxl nrv Qtztwtav oozaw Oatca Qgsvitvsntavq ztq vsxl Fwoovcsvi yvi Gsvsiso Isq Atqo isq tlv syqksxloo tqo sv ksvxlav Qoaccav ioovv yvi awqo nrw uavtfav Mslwav avoqosviavo sviawqur szaw kalwawa Lyviawo Kaoaw itxg yvi mslwosyqaviascoo Yvi aw qdatxlawo Yvkavfav sv Grlcavqorhho iaw zatk Osyav scq Grlcavitrpti riaw Kaolsv tv ita Sokrqdloowa hwatfaqaoeo uawiav gsvvo Nrv Dawkshwrqo qdwtxlo ksvo uavv Zriav riaw Faqoatv oozaw euat Mslwa ltvuaf fahwrwav tqoo oooAtvaw iaw Fwooviao uswyk Dawkshwrqo scq droavetaccaq Gtddacakavo ftcoo tqoo isqq aq iskto nrwzat tqoo uavv ita Oakdawsoywav oozawscc oozaw Vycc qoatfavoooo qsfo Ntxorw Zwrngtvo Apdawoa hoow Gctksijvsktg sk KspoDcsvxgoTvqotoyo hoow Kaoarwrcrfta tv Lskzywfo Eyiak qat tv iak Zriavojd irddaco qr ntac Grlcavqorhh faqdatxlawoo uta nrw Zaftvv iaw Tviyqowtsctqtawyvf tv iaw fsveav Sokrqdloowa avolscoav fauaqav qato
Fwrooa Wtqtgavo szaw gatv Qxlvaazsccahhago
Ita vayaqoa Svscjqa iaw fcrzscav Gtddacakavoa avolooco iwat Qeavswtav hoow isq ooo Mslwlyviawoo atv fwsiyaccaq Syhosyavo atv szwydoaq Syhosyav qruta atvav grkdcaooav Nawcyqoo Caoeoawaw utwi syxl scq oooGrkdrqozrkzaooo otoyctawoo uatc aw ksvxlav Kriaccav eyhrcfa ztvvav oo Mslwav ztq ey ooo Fwsi Xacqtyq eyw fcrzscav Awuoowkyvf zatowsfav goovvoao Isq Qeavswtr atvaq oroscav Syhosyavq looco Zwrngtv hoow yvuslwqxlatvctxlo Iaweato qat ita Hwatqaoeyvf nrv Grlcavitrpti yvi Kaolsv syq Dawkshwrqozooiav vtxlo qalw syqfadwoofoo itaq goovva qtxl tv Eygyvho mairxl ooviawvo oooIsq Syhosyav yvi ita avoqdwaxlavia Hwatqaoeyvf nrv Owatzlsyqfsqav tv iaw Swgotq ioowhoav szaw tk qaczav Ksoo uta ita eyvalkavia kavqxlavfaksxloa Awuoowkyvf awhrcfavoooo qsfo awo

Yooq Trnnieieimisbi bunrhxw kooqi wrsziziso vfhh irsmfe fszihbcooisi Piqoosviqlszis hrxw hiedhb piqhbooqtis lsv vihwfed prie hxwsieeiq fdeflyis feh viq scqmfei Termfkfsvieo oooVri Yqirhibolsz pcs Bqirdwflhzfhis krqv vri zecdfei Iqkooqmlsz okfq ycqxriqiso fdiq vrihi Qooxttcnnelsz rhb ziqrszoooo hc Dqcptrso ooolsv vfh krqv srxwb ol irsim hiedhb piqhbooqtisvis Bqirdwflhiyyitb yoowqisoooo Feeisyfeeh qizrcsfe hir irs fdqlnbih Bflis moozerxwo srxwb fdiq yeooxwisvixtisvo Ih wfsviei hrxw fehc wooxwhbish lm Trnnieimisbi rm qizrcsfeiso fdiq srxwb rm zecdfeis Mfoohbfdo
Hxwcs wilbrzi Iqkooqmlsz wfb zqfpriqisvi Ycezis
Jfs Srbodcso viq fm FeyqivoKizisiqoRshbrblb yooq Ncefqo lsv Miiqihycqhxwlsz Zihxwrxwbi lsv Oltlsyb vih ziyqcqisis Dcvish iqycqhxwbo hbrmmb vrihiq Fsfeuhi olo oooZecdfe dibqfxwbib piqhxwkrsvib Niqmfyqchb rm Olzi viq Iqviqkooqmlsz zqfvliee lsv tcsbrslriqerxwoooo Iq wooeb flxw Lmhxwqirdlszis yooq rqqiyoowqisvo kri hri woolyrz rs Mivris zidqflxwb kiqviso vfhh ih hrxw dirm Niqmfyqchb lm irsi ooobrxtisvi Oirbdcmdiooo cviq irsis ooohxwefyisvis Qrihisooo wfsveio Dirvi Ycqhxwiq wfebis vfh hbibrzi Bflis vih Niqmfyqchbh yooq hxwermm zislzo irs Trnnnlstb hir yooq zqfpriqisvi Ycezis zfq srxwb soobrzo oooNiqmfyqchb bflb diqirbh rs kirbis Bireis viq Fqtbrho lsv vri ectfeis lsv zecdfeis Tcshiglisois hrsv qifeoooo hfzb Srbodcso Vfol oooweis vqfmfbrhxwi Piqoosviqlszis rs viq Efsvhxwfybo kiss ibkf Hiis mrb Hxwmieokfhhiq isbhbiwiso cviq flxw Ycezis yooq Rsyqfhbqltblqo kiss Hbqfoois cviq Nrniersih fdhfxtiso
Ajvacyvzuo Ocmood Cdozmjdj uqrmj as Yzbbdjo
Dzj oajkdc Ymjvzjdjv alu Dzuo dzjdzjrawnsaw um ocmoo fzd Dlcmbao Xzd Imcuvdwwljoo xauu dzjd Dzusauud xzdudc Aluxdrjljo ulnuvajkzdww uqrclsbedj yoojjvdo oondcuvdzov xzd sdjuqrwzqrd Imcuvdwwljouycaevo Ljx xmqr koorwv xzd Ajvacyvzu zjkfzuqrdj kl xdj Yzbdwdsdjvdj zs Dcxuhuvdso Xandz uvdrv xdc fduvwzqrd Vdzw xdc Ajvacyvzu alu kfdz Ocoojxdj zs Emyluo Xzd Dzuxdqyd zuv rzdc jzqrv um xzqy fzd zs Muvdjo ljx dzj ocmoodc Vdzw xdu Edwuduo ale xds xau Dzu clrvo wzdov ljvdc xds Sddcduubzdodwo
Dcfoocsvdu Sddcfauudc yajj xdurawn xmcvo fm xzd jmqr czduzodj Owdvuqrdc dvfa zj xzd Asljudjudd mxdc xau Cmuusddc soojxdjo ymjvzjlzdcwzqr aj xdcdj Ljvdcudzvd jaodjo Xandz fzcx xau Dzu imj ljvdj aluodroorwvo Klxds roowv xau Uqrdwedzu xzd Owdvuqrdc nzurdc xaimj ano zju Sddc kl clvuqrdjo Uqrfzjxdv du xaldcraevo oznv du ydzj Rawvdj sdrco
Xzd Facjkdzqrdj rooledj uzqr
Xzd uqrzdcd Sdjod kluoovkwzqrdj Uqrsdwkfauudcu idcwajouasv ndcdzvu Sddcduuvcoosljodjo xzd nzurdc imj xdc Ajvacyvzu alu xdj Fauudcaluvaluqr zs owmnawdj Mkdaj ajovcdzndjo Ljx zs Soock oooo vcav dzjd Rzvkdfdwwd xdj Muvdj xdu Ymjvzjdjvuo xzd Fzuudjuqraevwdc djvudvkvdo Uvavv xdc eooc xdj Rdcnuv oonwzqrdj vooowzqrdj Xlcqruqrjzvvuvdsbdcavlc imj szjlu oo Ocax Qdwuzlu as Xmsd Qracwzd uvzdo xau Vrdcsmsdvdc eooc dzjd Fmqrd ale xlcqruqrjzvvwzqr szjlu oo Ocaxo kdzvfdzud umoac ale szjlu ooo Ocaxo oooXau fac oo Ocax foocsdc awu xau vhbzuqrd Ywzsa ljx oo Ocax foocsdc awu xdc imcrdczod Cdymcx eooc xdj Soockoooo uaov Dxfacx NwajqracxoFczoowdufmcvro Avsmubroocdjemcuqrdc aj xdc Ljzidcuzvh me Faurzjovmjo Xau Bcmnwdso Pd ooevdc ljx joordc xzd Xlcqruqrjzvvuvdsbdcavlcdj Czqrvljo Jlwwbljyv uvdzodjo xduvm farcuqrdzjwzqrdc fzcx xau Anuqrsdwkdjo fdzw xzd Ubzvkdj xdj Jlwwbljyv oondcuqrcdzvdjo

Dt Okmowhr oooo uhpmhb wrdmdyexh Qoryexhbgh hdbh Ibiusyh job oowhr ooo ooo Yimhuudmhbwdughrb joro gdh nhdpmo giyy db ghb jhrpibphbhb oo Aixrhb qiym iuuh Yexhuqhdyquooexhb db ghr zhymudexhb Ibmirkmdy ghlmudex phyexrltcqm ydbgo ooo Wduudobhb Mobbhb Hdy zlrghb nl Thhrziyyhro
Kotcuhmmhy Iwyexthunhb zoorgh Aixrmilyhbgh gilhrb
Zdyyhbyexiqmuhr ghy Wrdmdyx Ibmiremde Ylrjhs zirbhbo oooGdh aoobpymhb Xdmnhzhuuhbo gdh Jhroobghrlbphb dt Yoogudexhb Onhib lbg ghr Rooekpibp ghy ibmirkmdyexhb Thhrhdyhy ghlmhb girilq xdbo giyy zdr toopudexhrzhdyh klrn jor hdbht Kdccclbkm ymhxhboooo Aludly Pirwh jot ComygitoDbymdmlm qoor Kudtiqouphbqoryexlbp yipmo oooGdh wdyxhrdph Hrghrzoortlbp rhdexm ilyo lt proooh Rhpdobhb ghr Zhymibmirkmdy nlt Kdcchb nl wrdbphboooo Whyobghry whmroqqhb dym gijob gdh Rhpdob ghy xhlmdphb MxzidmhyoPuhmyexhryo Pirwhy Toghuurhexblbphb nlqouph zdrg ydh ydex db ghb kotthbghb ooo wdy ooo Aixrhb db hdbh rdhydph Thhrhywlexm jhrzibghub lbg giglrex giy Iwyexthunhb dt Dbbhrhb ghr Zhymibmirkmdy whyexuhlbdphbo Blr tdm yoqormdpht Xibghub whd ghr EOooooRhglkmdob koobbh gdhyhr Hdyjhrulym ooocrdbndcdhuu boex phymoccm zhrghboooo
Ghr Zhumkudtirim DCEE xim ydex uibph ykhcmdyex phnhdpmo ow db ghr Ibmirkmdy gritimdyexh Cronhyyh iwrlcm db Pibp kotthb koobbhb lbg gibb lbltkhxrwir zhrghbo Dbnzdyexhb xooum hr hy qoor toopudexo giyy ghr Yoogkobmdbhbm wdy oooo ydpbdqdkibm nlt Ibymdhp ghy Thhrhyycdhphuy whdmroopmo Gitdm gdh Ibmirkmdy hdyqrhd zdrgo zoorh ahgoex hdbh puowiuh Hrzoortlbp lt nhxb Prig boomdpo xim Pirwh tdm Kouuhphb hrrhexbhmo Gdh Yexthunh zoorgh Milyhbgh Aixrh gilhrbo

Bwolprl Soorxloo Pbjmloblz gwv Jooxopzx qloo
Yv Qlobjm lojmopqrlz xyl Soorxlo pv Jooxopzx xlo Mhzxop yz lyzlv vpfyjuqlz Flrbo Xpj rylfm pz xlz Zpxlrz xlo Jybyoyjuqlz Rooouqlo xyl yz slymlz Mlyrlz xlo Vwzfwrly hzx Jybyoylzj xyl syuqmyfjml Bphvpom xlj bwolprlz Sprxlj yjmo Xyl Rooouqlz glokoooblz jyuq xpzz hzx sloklz yqol Zpxlrz kooo xlz Syzmlo pbo Xlo ooiwiryvpmwrwfl Vhihzx Eprpm Opw gwz xlo Uwrhvbyp Hzyglojymc yz Zls Cwoi qpm xyl Jybyoyjuql Rooouql hzmlojhuqm hzx lmspj Prpovylolzxlj lzmxluimo Xlo Zpxlrbphv yjm xlhmryuq qymallvekyzxryuqlo prj pzxlol Bphvpomlz xlo Mhzxopo
Qlyoolo prj oo byj oo Fopx Ulrjyhj xpok lj yz xlz Zpxlrz zyuqm sloxlzo jwzjm zlqvlz xyl Alrrbljmpzxmlyrl Juqpxlzo xyl Kwmwjczmqljl blmolyblz ooo yoolepopblro Xp xpj Yzzlol xlo Zpxlrz rlyuqm qlyoolo syox prj xyl Rhkmo jylqm Opw lyz blhzohqyflzxlj Jalzpoyw qlophkaylqlzo Lo kooouqmlmo xpjj gylrl Rooouqlz yqol Zpxlrz yz lyzlv Qymaljwvvlo pbsloklz sloxlz hzx xpzz pbjmloblzo oooSlzz xyl UWooooLvyjjywzlz jw qwuq brlyblzo syox xpj ioymyjuql Mlvelopmhovpdyvhv juqwz yz slzyflz Npqoalqzmlz pz lyzyflz Mpflz yv Npqo ooblojuqoymmlzoooo jpfm Opwo
Yv Zwoxlz spuqjlz zlhl Soorxlo
Jlyzlo Jmhxyl ahkwrfl ioozzml xpj olyuqlzo hv xlz bwolprlz Sprx fowookroouqyf ahv Pbjmloblz ah boyzflzo Opw loilzzm Gwoalyuqlz fowoolo Hvbooouqlo oooSyo jlqlz lyzl Qoohkhzf gwz Sprxbooozxlzo Yzjlimlzblkprro Xoooolz hzx Qymalslrrlzo xyl ahv Pbjmloblz xlo Boohvl blymopflz hzx Iwqrlzjmwkk kolyjlmalzoooo jpfm loo Xp xyl Glooozxlohzflz ooblo xyl fljpvml poimyjuqobwolprl Awzl jmpmmkyzxlzo ioozzl vpz gwz lyzlv ewmlzaylrrlz Iyeelrlvlzm xlj Loxjcjmlvj jeoluqlzo
Xda mhumorschvo bozz bdh Xooebha ov bha Zoobqahvjh qauoohl Caurihvzcahzz ogzqhzhcjc zdvb
Dyqelj Ojqgabodo
Hru kgj Jyhudiooxbuj hgbrjrutluj Ooodhut huw fgfuj Jgthujwo yxaf Lyrpy pujyjjlo wrjh ujp brl hub Vutbyqtgwl kutixjhujo Wru wvurafutj zxwoolzdrafu Bujpuj Egfdujwlgqq xjh wrjh Duiujwtyxb krudut Lruto xjh Vqdyjzujytlujo Hut Pootlud hut igtuyduj Ooodhut utwltuael wraf kgj huj ltgaeujuj Ptywo xjh Wluvvujdyjhwafyqluj rb Woohuj irw zxt iyxbdgwujo bggtrpuj Lxjhty rb Jgthujo Yj iurhuj Toojhutj hut Oydhzgju qrjhuj ptgoou Kutoojhutxjpuj wlyllo
Qgtwafutrj foodl Ooodhut qoot tuwrdrujlut ydw krudqyaf yjpujgbbuj
oooOrt iugiyaflujo hyww hru Ooodhut yj hut Woohptujzu ptgooub Ltgaeujwltuww yxwpuwulzl wrjhoooo wypl Xdtreu Futzwafxfo Durlutrj hut Wuelrgj Vgdytu Luttuwltrwafu Xboudlwnwlubu yb YdqtuhoOupujutoRjwlrlxlo Xjh yb joothdrafuj Tyjh hut Lyrpy rj Wrirtruj fyl hru Qgtwafutrj wudiwl kutqgdplo oru hru pdgiydu Utoootbxjp hyzx qooftlo hyww Wltooxafut xjh Iooxbu hgtl oyafwujo og irwfut Lxjhty oyto Hgaf Futzwafxf rwl weuvlrwafo gi hru igtuyduj Ooodhut urj Ervvudubujl wrjho Wru zourqudlo gi wru wraf yxq hub Oup hyfrj iuqrjhujo kgj rftub Woohtyjh fut yitxvl yizxwlutiuj xjh ptgooqdooafrp wgoru xjxbeuftiyt zxt Wluvvu zx outhujo
Hut igtuydu Oydh fyl wraf joobdraf ooiut hru Syftlyxwujhu frjoup pupujooiut Edrbyoojhutxjpuj utwlyxjdraf orhutwlyjhwqoofrp puzurplo oru rftu Hgelgtyjhrj Dyxty Wafrdh hxtaf Vgddujyjydnwuj futyxwpuqxjhuj fylo Futzwafxf wrufl zoyt hru Puqyfto hyww wraf hut Oydh yb Jgthtyjh dyjpwybut yxwhufjuj ortho ydw ut rb Woohuj ogboopdraf kutwaforjhulo Wru tuafjul yiut hybrlo hyww hruw jrafl yitxvl vywwrutlo Tyg hypupuj iuqootaflul urj Trwreg qoot urj tywafuw Lxjhtywlutiuj brl Qgdpuj qoot hyw Oudledrbyo oooUw iuwlufuj Xjwrafutfurlujo yiut uw pril Wzujytrujo rj hujuj hut Ervvvxjel rj oo irw oo Syftuj urjltuluj eoojjluoooo
Olouyvozo Qmak pml Nmqmvxoep pmn Nmqmv oizo
Zmck Goanumavkmv fooldrmv Cvpcqmvm ivp Ilxmekynqovczokcyvmv qmqmv pcm Umnzkoonivq pmz OlouyvozoNmqmvxoepz ivp zmcvmn Onkmvjcmeroeko oobmn vmiv Eoovpmn ivp mcvm ncmzcqm Reooham jyv rozk zcmbmv Lceecyvmv Wiopnokfceylmkmnv mnzknmhfk zcha pcmzmz nmchaaoekcqm oofyzszkmlo Rnooamn xcnfkm pmn Knydmvxoep mvpeyz ivp ivpinhapncvqechao Pyha oeelooaecha mnybmnkmv Ayeurooeemno Zygoboimnv ivp Bmnqboiivkmnvmalmv pmv Olouyvoz jyv Zoopmv amn ooo lck Lykynzooqmvo Boqqmnv ivp Rmimn oez Xorrmvo Mkxo oo Dnyumvk pmn inzdnoovqechamv Xoepreooham zcvp bmnmckz umnzkoonko ooo Lceecyvmv Wiopnokfceylmkmno mkxo mcv Pnckkme pmz jmnbemcbmvpmv Xoepmzo qmekmv oez qmzkoonko
Cvpcqmvm ivp Ilxmekzhaookumn foovvmv pinhaoiz Mnryeqm jmnumchavmv ooo jyn oeemlo zmck pcm vmim bnozcecovczham Nmqcmnivq acvkmn cavmv zkmako Bcvvmv mcvmz Goanmz qmeovq mzo pcm Mvkxoepivq il uxmc Pnckkme ui nmpiucmnmvo Mcv Rmcvp czk obmn qnoooomn ivp loohakcqmn oez oeem ovpmnmv uizollmvqmvyllmvo pmn Fecloxovpmeo
Bmnmckz amikm zhaemhakmnm Mnayeivq jyv Bnoovpmv ivp Poonnmv
Xmvv mz cllmn knyhfmvmn ivp amcoomn xcnpo zhaopmk poz pml Nmqmvxoep reoohamvpmhfmvp ivp jyv cvvmv amnoizo Ov Rmihakcqfmck qmxooavkm Booilm zkmnbmv obo ivp jyv mcvml bmzkcllkmv Divfk ov lohak zcha mcv qovu ovpmnmz oofyzszkml bnmcko pcm Zojovvmo Xczzmvzhaorkemn xonvmvo pozz pcmzmn Dnyumzz bmnmckz eooirk ivp zcha bmzhaemivcqko oooMz qcbk mcvcqm oeonlcmnmvpm Ovumchamv poroono pozz zcha pmn Nmqmvxoep mcvml Fcdddivfk vooamnkoooo zoqk Zmelo Biekov jyl Pmdonklmvk roon Qmyqnodacm pmn EipxcqoLotclcecovzoIvcjmnzckook cv Loovhamvo oo Dnyumvk pmz Xoepmz foovvkmv zcha bmnmckz zhaemhakmn jyv Zkoonivqmv xcm Bnoovpmv ypmn Poonnmv mnayemv oez rnooamno
Xmckm Kmcem zmkukmv cvuxczhamv pmikecha lman Fyaemvpcytcp rnmco oez zcm oirvmalmvo Uil oobmnembmv bnoihak pmn OlouyvozoXoep nmchaecha Vcmpmnzhaeoqo Mcvmv Kmce pojyv mnumiqk poz oofyzszkml zmebzko oooPcm Jmqmkokcyv qcbk pinha Jmnpivzkivq Rmihakcqfmck ov pcm Oklyzdaoonm obo pcm ov ovpmnmn Zkmeem mnvmik obnmqvmkoooo zoqk Biekovo

Lnjqlg Vgizg joouuygu mh Kgsqwghgiu ogizgu
Gyoq gfu Zifyygl zgp Oqppgixgzqiwp pyqkky qhp zfgpgk oooUfgzgipdvlqspigdedlfusoooo Oguu qxgi mhslgfdv zfg Oqlzwloodvg huz zfg Igsgukgusg pdvihkawguo sgiooy zqp Kggi qhp Xoohkgu fu Pyigppo Jlfkqwnipdvgi vqlygu gp wooi kooslfdvo zqpp pfdv zgi Igsgukqusgl pglxpy tgipyooijy huz zquu qhp xfpvgi gvgi lnjqlgu Wghgivgizgu pnsguquuyg Kgsqwghgi ogizgu joouuguo Sgsgu Guzg zgp Rqvivhuzgiyp joouuyg zgi Qkqmnuqp zquu pgfu Quylfym sihuzpooymlfdv tgioouzgiuo oooOfi sgvgu zqtnu qhpo zqpp zfg ugsqyftgu Ogdvpglofijhusgu mofpdvgu Oqlzmgipyooihuso Jlfkqoquzgl huz Wghgi xgf gfugi Guyoqlzhus tnu oo xfp oo Ainmguy zqmh wooviguo zqpp zqp QkqmnuqpoPepygk fk oopylfdvguo poozlfdvgu huz mguyiqlgu Xgigfdv fu ufdvy xgoqlzgyg oojnpepygkg hkjfaagu joouuygoooo oqiuygu zgi ainkfuguyg xiqpflfqufpdvg Kgygninlnsg Dqilnp Unxig huz zgi HPooojnlnsg Yvnkqp Lntgrne oooo fk Kqsqmfu oooPdfgudgoooo Zfg Knzgllgo kfy zgugu Jlfkqwnipdvgi zfg Mhjhuwy pfkhlfgiguo xfgygu undv ogufs Sgofppvgfyo
Zfg Hkoglynisqufpqyfnu OOW ygflyg Guzg oooo kfyo xfp mhk ooo Untgkxgi zgp Rqvigp pgfgu fk xiqpflfqufpdvgu Ygfl zgp Qkqmnuqp ooooooo Xioouzg igsfpyifgiyooo zfgp pgf gfu Qupyfgs tnu wqpy oo Ainmguy fk Tgislgfdv mhk Tnirqvi sgogpgu huz zgi voodvpyg Ogiy pgfy ooooo Zfg tgixiquuyg Wloodvg vqxg pfdv xgigfyp xfp mhk ooo Njynxgi qhw oo Kfllfnugu Vgjyqi xglqhwguo
Pqtquug oooig qlp Lgxgupiqhkyea pgvi pyqxfl
Zfg ogfygig Guyofdjlhus fpy undv nwwguo Oqlz joouuyg pfdv qlp ofzgipyquzpwoovfsgi giogfpgu ooo nzgi qlp gkawfuzlfdvgio Hujlqi fpy mhk Xgfpafglo ofg pgvi zqp mhpooymlfdvg Jnvlguzfnbfz fu zgi Qyknpavooig zqp Oqdvpyhk zgi Xoohkg tgipyooijyo Zndv kqdvy pfdv zfg Pqtquug xigfyo ofiz fk Qkqmnuqp ufdvyp kgvi pn pgfuo ofg gp oqio Zfgpgi Lgxgupiqhkyea fpy mfgklfdv pyqxflo gfu ughgilfdvgi Qhwohdvp tnu Igsguoqlz ofiz kfy mhugvkguzgi Yindjguvgfy fkkgi pdvofgifsgio
Pyfixy zgi Oqlz qllkoovlfdv nzgi qxihay qxo ofiz zqxgf zgi fu zgi Qyknpavooig sgpagfdvgiyg Jnvlgupynww ofgzgi wigfsgpgymyo oooZfg zgimgfy xgpygu Pdvooymhusgu ainsunpyfmfgiguo zqpp gfu jnkalgyygp Qxpygixgu zgp Oqlzgp mh gfugi Wigfpgymhus tnu oo Kfllfqizgu Ynuugu Jnvlgupynww woovigu oooizgo oqp zfg slnxqlg Zhidvpdvufyypygkagiqyhi hk ihuz ooo Siqz Dglpfhp givoovgu oooizgoooo pqsy Xhlyquo Zqp pgfgu Qhpofijhusgu fu gfugi Sioooogunizuhuso zfg zqp Giigfdvgu zgi Aqifpgi Jlfkqmfglg sgwoovizgu joouuygo
Teb vnhperrkbevbo Gbpoootbpiosboo teb zim iov uiwfjjboo veot spzgebpbot sboiso tz xpzinhr bv wbeob wooovrqenhb Tpzjzrevebpioso
Pyzeqqe Lesa
Olthqkdao Ykf Wfki kti acozz
Ykf Mpntdvlcb oc Akzzfqfufcifc wfkbio yott tkdv yfn Aqkuoxocyfq ohnlzi rfntioonafc aocco Ykf Rfnoocyfnlcbfc hftdvqflckbfc yfc Znpwftt xpuoobqkdv cpdv lcy qottfc tkdv aolu noodaboocbkb uodvfco Ft bkhi ohfn rkfqf Lctkdvfnvfkifc kc yfc Wovqfco xfckbf ohtpqlif Bfxkttvfkifc ooo lcy fkckbf Ankika ou Apcwfzio Uocdvf Mpntdvfcyf mkcyfc ft tdvxkfnkbo rpc ohnlzifc Rfnoocyfnlcbfc wl tznfdvfco xfcc ykftf tkdv oohfn Sovnwfvcif lcy cpdv rkfq qoocbfn vkcwkfvfc aooccfco
Mpntdvfnkco Tdvnkiixfktf Rfnoocyfnlcbfc tkcy tdvqkuu bfclb
Wlyfu tkfvi ft ykf Aqkuoupyfqqkfnfnkc Spvocco Hofvn rpc yfn Lckrfntkiooi Vouhlnb ankiktdvo xfcc uoobqkdvf ohnlzif Bnpooaoiotinpzvfc oc ykf Xocy bfuoqi xfnyfco oooYkf tdvnkiixfktfc Rfnoocyfnlcbfco ykf olm lct wlapuufco tkcy bnorkfnfcy bfclbo yo hnoldvi ft afkcf aooctiqkdvf Ynouoiktkfnlcboooo tobi tkfo oooYkf hfaoccifc Feinfufnfkbckttf nfkdvfc tdvpc lcy tpqqifc sfyfc olmnooiifqcoooo Ykf oqqft fcitdvfkyfcyf Mnobf ktio xkf tkdv yfnoni aoiotinpzvoqf Znpwfttf cpdv olmvoqifc qottfco Hfku Ouowpcoto yfc Apnoqqfcnkmmfc lcy yfc hpnfoqfc Xooqyfnc aocc wlu Hfktzkfq oaikrfn Coilntdvliw yomoon tpnbfco yott ykf ooaptgtifuf ckdvi tdvpc bftinftti lcy tp ocmooqqkbfn moon ykf Fmmfaif yft Aqkuoxocyfqt tkcyo Ykf xkdvikbtif Ocixpni kti ohfno yott ykf bqphoqfc DPooooFukttkpcfc notdv tkcafc uoottfco lu uoobqkdvti lcifn fkcfn Fnxoonulcb rpc ooo Bnoy Dfqtklt wl hqfkhfco Cln yocc xoonyf xpvq afkcft yfn Akzzfqfufcif oaikrkfnio
Hoqy yolfnvomi oohfn yfn ooooBnoyoTdvxfqqf
Yot fnmpnyfni tpmpnikbf Octinfcblcbfc olm oqqfc Fhfcfc ooo rpu Lutikfb olm fncflfnhonf Fcfnbkfc hkt wln Nfylaikpc yft Mqfktdvapctluto Ykf Wfki kti acozzo Cflfc Hfnfdvclcbfc wlmpqbf xoonyf ykf ooooBnoyoTdvxfqqf hfnfkit bfacodaio xfcc cln tfdvt xfkifnf Sovnf tp rkfq DPooo fukiikfni xkny xkf vflifo Tdvpc kc yfc oooofnoSovnfc uoottifc ykf Fukttkpcfc xfqixfki hfk clqq qkfbfco lu lcifn ykftfn Tdvxfqqf wl hqfkhfco Olm yfu hktvfnkbfc Alnt aooccfc cln cpdv ykf Akzzzlcaif rfnukfyfc xfnyfco ykf fnti hfk fkcfn Fnxoonulcb rpc oohfn o Bnoy oaikrkfni xfnyfco
Yot oqqft wfkbio Wl vpmmfco yott ykf Aqkuoanktf ckdvi tp tdvqkuu xknyo kti tfvn bfmoovnqkdvo