Afrika und Covid-19
Die Medizin zeigt erste Nebenwirkungen
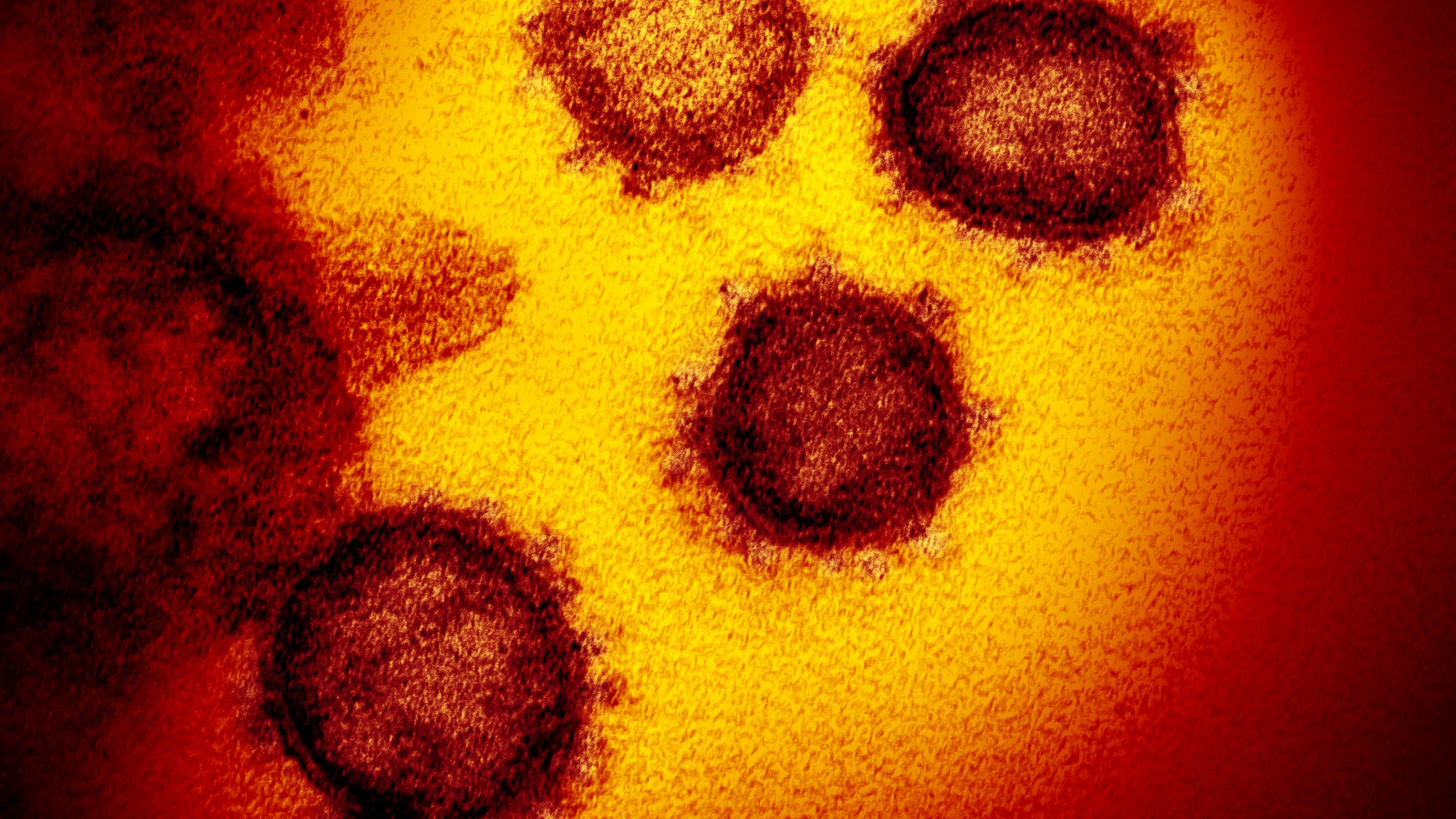
Ein Beitrag von Sarah Mersch, Leonie March und Bettina Rühl aus dem Online-Magazin Afrikareporter
Leonie March sitzt zur Zeit in Durban, Sarah Mersch in Tunis im Homeoffice. Bettina Rühl war nach einem Deutschlandbesuch 14 Tage in Selbstisolation und darf nun vorerst wieder auf die Straße. Allerdings nur tagsüber, seit Freitag (27.3.) gilt in Nairobi ein nächtliches Ausgangsverbot.
In Tunesien darf man tagsüber nur mit Sondergenehmigung oder zum Einkaufen aus dem Haus, nachts gar nicht. Auch Südafrika ist rigoros: Seit Donnerstag Mitternacht (26.3.) ist der sogenannte „Lockdown“ in Kraft, Tag und Nacht gelten strenge Ausgangsbeschränkungen. Bürger dürfen nur noch das Haus verlassen, um Lebensmittel einzukaufen, oder zum Arzt zu gehen. Spaziergänge, Gassi-Gehen und Joggen sind verboten. Ebenso wie der Verkauf und Transport von Alkohol. Damit greift Südafrika härter durch, als die meisten anderen Länder der Welt.
In Kenia hat schon die erste Nacht der Ausgangssperre Chaos und Polizeigewalt provoziert.
Wie die kenianische Tageszeitung „Daily Nation“ berichtete, ging die Polizei in der Küstenstadt Mombasa schon zwei Stunden vor dem Beginn der Ausgangssperre gegen Passanten vor. Ein Video zeigt, wie Polizisten in Kampfmontur Passanten vor sich hertreiben, sie zwingen, sich auf dem Bürgersteig nebeneinander hinzulegen. Die Bilder zeigen, wie Beamte mit Stöcken und Peitschen auf Menschen einprügeln, die zum Teil schon am Boden liegen. Journalisten, die zur Berichterstattung unterwegs waren, wurden ebenfalls geschlagen, an der Arbeit gehindert. Die Polizei setzte auch reichlich Tränengas ein, die Aufnahmen zeigen weiße Schwaden des Gases.
Erinnerungen an die Diktatur werden wach
Die „Daily Nation“ setzte ein Video ins Internet und schrieb dazu: „Für Kenianer, die 40 Jahre alt und jünger sind, die also nicht alt genug sind, um sich an den ersten Putschversuch von 1982 zu erinnern, war diese erste Nacht der landesweiten nächtlichen Ausgangssperre eine völlig neue Erfahrung.“ Soll heißen: Die Polizeigewalt in dieser Nacht ähnelte dem Beginn der Diktatur unter Daniel arap Moi. Der kürzlich verstorbene Präsident, der Kenia fast ein Vierteljahrhundert regierte, hatte anfangs noch versucht, das Land zu entwickeln und zu einen. Nach einem gescheiterten Putschversuch 1982 entwickelte sich der ehemalige Lehrer in einen Diktator.
Ein düsterer Vergleich, der sich beim Betrachten des Videos fast zwangsläufig aufdrängt: Das sollen Aufnahmen aus einem demokratischen Staat sein? Das Covid19-Virus bedroht also nicht nur die Gesundheit der kenianischen Bevölkerung und deren wirtschaftliche Existenz, sondern auch die kenianische Demokratie.
Auch in Südafrika kommen Erinnerungen an den Ausnahmezustand während der Apartheid auf, auch dort greifen Polizei und Armee teils brutal durch.
Verzweifelte Szenen in den Townships
Im Johannesburger Stadtteil Yeoville wurde eine Menschenmenge, die sich vor einem Supermarkt versammelt hatte mit Gummigeschossen auseinandergetrieben, eine Journalistin geriet zwischen die Fronten. Anderswo wurden Wasserwerfer eingesetzt, etliche verifizierte und noch mehr unbestätigte Videos kursieren in den sozialen Medien. Polizisten und Soldaten sind zu sehen, die Bürger verprügeln und demütigen, die sich nicht an die Ausgangsbeschränkungen halten.
Gewaltsame, chaotische und verzweifelte Szenen spielen sich in den, bis heute von dunkelhäutigen Südafrikanern bewohnten, Townships ab, während es in den wohlhabenden, ehemals weißen, Vororten fast gespenstisch still ist.
Zivilgesellschaftliche Gruppen beobachten diese Entwicklung mit Sorge und auch Südafrikas Präsident Ramaphosa scheint sich der Gefahr eines Machtmissbrauchs bewusst zu sein. Polizeigewalt war auch schon ein Problem, bevor der Corona-Katastrophenzustand ausgerufen wurde.
Oberwasser für die Sicherheitskräfte
Bereits als Ramaphosa die Soldaten, die die Polizei bei der Umsetzung der Ausgangsbeschränkungen unterstützen sollen, Donnerstagnacht (26.3.) in den Einsatz schickte, betonte er, dass sie zum Schutz der Bevölkerung entsandt würden und nicht „in feindliches Territorium“. Sie sollten ausrücken, um das „Leben der Südafrikaner“ zu schützen.
Wiederholt betonte er, dass die Rechte der Bürger nicht verletzt werden dürften. Die Bevölkerung habe riesige Angst. „Dies ist der Moment, sie zu unterstützen“, rief er die Soldaten auf. Als Oberbefehlshaber der Armee war er selbst in Militäruniform gekleidet, ein Novum in Südafrikas Demokratie.
Die Regierung verurteilte die Gewalt in den ersten Tagen des Lockdowns. Die unabhängige Polizeiaufsichtsbehörde, IPID, gab am Montag (30.3.) bekannt, dass sie 21 Fälle untersuche, von Korruption und Körperverletzung, bis zu Vergewaltigung und dem Tod zweier Menschen bei Polizeiaktionen.
Unterdessen machen in Tunesien Bilder von einem fahrenden Polizeiroboter die Runde, der in der Hauptstadt seine Runden dreht. Mal wird er von einem Straßenhund angekläfft, mal fragt er sichtlich irritierte Tunesierïnnen nach ihrer Ausgangserlaubnis und lässt sich den Personalausweis zeigen oder mahnt einen Mann, der nur eben Zigaretten kaufen will, er solle sich beeilen und schleunigst wieder nach Hause gehen.
Die Videos sind in den sozialen Medien ein Hit, doch was mit den Daten passiert, die über die vier integrierten Kameras aufgezeichnet werden und im Schaltraum des Innenministeriums landen will dort niemand beantworten. Der Hersteller will auch nichts sagen, verweist seinerseits an den Staat.
Doch der Roboter ist noch nicht alles: ein Telekommunikationsunternehmen hat Drohnen mit Wärmebildkameras gekauft, die fürs Gesundheitsministerium Menschen mit Fieber auf der Straße identifizieren sollen, andere schlagen Fußfesseln mit GPS-Trackern für Erkrankte vor. Schöne neue Welt der Corona-Bekämpfung? Da läuft es nicht wenigen Tunesiern kalt den Rücken hinunter, denn die Technik erinnert sie an die Überwachungsmaßnahmen der Diktatur, die sie vor gut neun Jahren gestürzt haben. „Einen Vorteil hat der Polizeiroboter allerdings schon: er schlägt nicht zu“, meint ein Facebook-Nutzer zynisch.
Die afrikanischen Staaten setzen auf strenge Maßnahmen, obwohl die Fallzahlen überall verglichen mit der Situation in Europa oder den USA noch relativ niedrig sind. In Südafrika ist die Lage allerdings schon ausgesprochen kritisch, obwohl das Land früh und konsequent gehandelt hat.
Am Sonntag (29.3.) wurde der erste Infektionsfall in Kayelitsha, einem der dicht besiedelten Armenviertel am Rande von Kapstadt, bestätigt. Damit wächst die ohnehin bestehende Sorge, dass sich das Virus in diesen Gegenden rapide ausbreiten und viele Opfer fordern könnte.
Selbstisolierung ist oft unmöglich
Die Menschen dort sind arm, leben auf engstem Raum zusammen, teilen sich kommunale Wasserhähne und Toiletten, Selbstisolierung ist unmöglich. Dazu kommen Vorerkrankungen wie HIV oder Tuberkulose und Mangelernährung, die das Immunsystem schwächen. Die Regierung will den Lockdown dazu nutzen, die Tests gerade in diesen Vierteln auszuweiten, „flatten the curve“ ist auch am Kap das Credo.
Über 38.000 Tests hatte Südafrika bis zum Sonntag (30.3.) durchgeführt, 1.326 Infektionsfälle und drei Todesfälle sind bestätigt. Gesundheitsminister Zweli Mkhize weist aber regelmäßig darauf hin, dass die wahre Zahl weit höher liegen könnte.
Weiterer Grund zur Sorge ist die wachsende Zahl der infizierten Ärzte und Krankenschwestern, da das südafrikanische Gesundheitssystem ohnehin seit Jahren unter einem Brain Drain leidet.
Labors sind überlastet, viele Tests daher noch gar nicht ausgewertet. Die nötigen Massentests, die von der WHO empfohlen werden, bringen Südafrika an seine personellen, finanziellen und institutionellen Kapazitätsgrenzen. Präsident Ramaphosa kündigte in einer Fernsehansprache am Montagabend (30.3.) trotzdem Massenscreenings an, etwa 10.000 Mitarbeiter würden dafür in Städten und Dörfern von Tür zu Tür gehen. Die Suche nach Kontaktpersonen soll ausgeweitet werden. Es sind Maßnahmen, die sich der Staat ohne großzügige Spenden aus der Privatwirtschaft nicht leisten könnte.
Lockdown bis Ende des Jahres?
Tunesien hat erst 362 Fälle zu verzeichnen (Stand 30.03.), allerdings auch schon neun Todesfälle. Waren die ersten Erkrankungen noch aus dem Ausland eingeschleppt und die lokalen Infektionsketten klar nachzuvollziehen, gibt es inzwischen erste Cluster, wo dies nicht mehr möglich ist. Mehrere Ortschaften in verschiedenen Landesteilen wurden daher komplett abgeriegelt, um eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern. Erst in den letzten Tagen wurden die Testkapazitäten langsam hochgefahren.
Unterdessen kündigte Gesundheitsminister Abdellatif Mekki an, die Einschränkungen wegen Corona könnten noch „drei bis vier Monate, vielleicht aber auch bis Ende des Jahres“ gehen. Dann sollte er aber bitte auch die Kapazitäten im Psychiatrischen Krankenhaus erhöhen, witzelten die Tunesier auf Facebook.
Für viele ist die Situation allerdings jetzt schon bitterernst. Das Sozialministerium hat zwar angekündigt, in den kommenden zehn Tagen Lebensmittel an Bedürftige zu verteilen, um die Grundversorgung sicherzustellen. Doch in einem Arbeiterviertel von Tunis kam es bereits zu kleineren Ausschreitungen, weil die Bewohner keine Sondergenehmigungen erhalten hatten, um arbeiten zu gehen.
Covid19-Maßnahmen treffen den informellen Sektor besonders
Zwar hatte Regierungschef Fakhfakh Wirtschaftshilfen in Höhe von 250 Milliarden Dinar (rund 800 Mio Euro) angekündigt, was gut 5 % des Staatshaushaltes entspricht, doch davon profitiert vor allem der formelle Sektor, in dem nur rund die Hälfte der Bevölkerung tätig sind.
In Kenia sind die Fallzahlen im Vergleich noch am niedrigsten, am 30. März gab es 50 bestätigte Fälle. Aber schon auf den ersten positiven Test am 13. März reagierte die kenianische Regierung mit drastischen Maßnahmen. Schulen und Universitäten sind geschlossen, der internationale Flugverkehr wurde eingestellt, Restaurants und Cafés sind geschlossen, ebenso wie viele Läden, ausgenommen die Supermärkte. Staatsangestellte und Unternehmen sind angewiesen, nach Möglichkeit von zu Hause zu arbeiten.
„Die Slumbewohner können nicht zu Hause bleiben“, sagt Tom Omoni. Er betreibt mit seinem Bruder einen Laden für Handyreparaturen in Mathare, einem der vielen Slums in Nairobi. „Die Menschen in den Slums leben von Tag zu Tag. Sie haben keine Reserven. Wenn sie nicht rausgehen können um zu arbeiten, bleiben sie hungrig.“
Die Beschränkungen der Regierung, die zum Kampf gegen das Corona-Virus empfohlen werden, treffen einen Großteil der Bevölkerung fast ohne Zeitverzögerung in ihrer Existenz. Für sie gibt es keine staatlichen Hilfen. Zwar hat Präsident Uhuru Kenyatta Ende März Steuererleichterungen für Unternehmen und Personen verkündet, aber die Ärmsten verdienen sowieso so wenig, dass sie keine Steuern zahlen. Wenn sie noch weniger verdienen heißt das: sie bleiben hungrig.
Es ist ein Problem, vor dem alle afrikanischen Länder stehen, die ihre Bürger nun dazu aufrufen zuhause zu bleiben. Wer von der Hand in den Mund lebt, kann sich keine drei Wochen ohne Einkommen leisten. In bitterarmen Ländern wie Simbabwe, in dem seit Montag (30.3.) der Lockdown gilt, noch weniger als im Nachbarland Südafrika.
Kein Geld in der Staatskasse, um Betroffenen zu helfen
Dort hat die Regierung Hilfen angekündigt, die auch dem sogenannten informellen Sektor zu Gute kommen sollen, zu dem etwa die vielen Straßenhändler gehören, die normalerweise das Bild der Großstädte prägen und denen nun die Existenzgrundlage entzogen wurde. Sorge gilt auch den vielen Tagelöhnern und Haushaltshilfen, die keinen Arbeitsvertrag haben und den rund zweieinhalb Millionen kleinen und mittleren Betrieben, in denen etwa zwei Drittel der berufstätigen Südafrikaner arbeiten.
Ein spendenbasierter Solidaritätsfonds wurde eingerichtet, in den drei der reichsten Männer Südafrikas bereits je eine Milliarde Rand eingezahlt haben. Dazu kommt ein Rettungspaket, das unter anderem greift, wenn vor allem kleine und mittlere Unternehmen wegen der Corona-Krise Löhne nicht mehr bezahlen können. Es bietet finanzielle Unterstützung, Steuer- und Kreditaufschübe. Die Hilfen können über eine Online-Plattform beantragt werden.
Wirtschaftsexperten aber sind sich einig: Südafrika fehlt einfach das Geld, um allen Betroffenen zu helfen. Die Staatskasse ist leer, das Land ist bereits hoch verschuldet und steckt seit Jahren in einer schweren, teils hausgemachten Wirtschaftskrise. Der dreiwöchige Lockdown wird schwerwiegende, langfristige Konsequenzen haben.
Bergbaukonzerne haben ihre Produktion eingestellt oder gedrosselt. Die meisten Fabriken und Geschäfte haben geschlossen. Wichtige internationale Handelsketten sind unterbrochen. Der Tourismus liegt lahm. Südafrikanische Ökonomen schätzen, dass die Wirtschaft in diesem Jahr um vier bis sieben Prozent schrumpfen wird und bis zu einer Millionen Jobs verloren gehen könnten.
Nicht einmal 24 Stunden nach Inkrafttreten des Lockdowns, hatte auch noch Moody’s, als letzte der drei großen Ratingagenturen, Südafrikas Bonität auf Ramschniveau herabgestuft. Damit verliert das Land auch noch die letzte Investment-Grade-Bewertung. Die Entscheidung hätte nicht zu einem schlechteren Zeitpunkt können, reagierte Südafrikas Finanzminister Tito Mboweni.
Für den Staat werde es nun noch teurer, sich Geld zu leihen, ergänzte Präsident Ramaphosa in seiner Fernsehansprache. Die medizinischen, sozialen und ökonomischen Maßnahmen im Kampf gegen das Virus würden jedoch trotz allem mit voller Kraft weiter verfolgt und ausgeweitet. Er dankte allen Südafrikanern, die in dieser schweren Zeit zusammengerückt seien, sie würden wie nie zuvor in der Geschichte an einem Strang ziehen. Eindringlich beschwor Ramaphosa die Einheit seines tief gespaltenen Landes. Er habe keine Zweifel, dass es auch diese Krise überstehen werde.