- RiffReporter /
- Umwelt /
Anthropozän: Der Kampf um die neue Erdepoche und die Geschichte geologischer Irrtümer
Anthropozän: Menschelnde Wissenschaft auf einem menschelnden Planeten
Vor einem Jahr lehnte es die Spitzenorganisation der Geologie ab, eine neue, nach dem Einfluss des Menschen benannte Erdepoche einzuführen. Doch die Kontroverse ist damit nicht beendet, im Gegenteil. Gerade in der Geologie wurden schon oft kapitale Irrtümer später korrigiert

Ein epochales Event nach 15 Jahren akribischer wissenschaftlicher Arbeit – so hatte sich eine Gruppe von Geologinnen und Geologen den nächsten Weltkongress ihrer Disziplin Ende August 2024 im südkoreanischen Busan vorgestellt. Dort wollten sie vor Tausenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern feierlich eine neue Zeitrechnung ausrufen: das Anthropozän (englisch Anthropocene), eine nach dem Einfluss des Menschen benannte neue geologische Erdepoche. Es sollte das aktuelle Holozän ablösen, das die 11.700 Jahre währende Warmperiode seit der letzten Kaltzeit umfasst.
Doch dann kam die große Überraschung: Aus der geplanten Epochen-Verkündung auf dem geologischen Weltkongress wird bis auf Weiteres nichts. Mit ihrer Empfehlung, die neue Erdepoche auszurufen, stieß die Anthropocene Working Group vor einem Jahr, im Frühjahr 2024, unerwartet auf Granit. Die Führungsspitzen der Organisation, die die Erdgeschichte in Kapitel und Unterkapitel einteilt, lehnte den Anthropozän-Vorschlag damals Ende März ab. Eine Erschütterung der Forscherwelt, die auch in den Medien viel Aufmerksamkeit erzeugte. „Das Anthropozän wird nicht als formaler geologischer Begriff anerkannt“, teilte die globale Dachorganisation der Geowissenschaften mit, die International Union of Geological Sciences (IUGS). Sie argumentierte, dass die vom Menschen verursachten Veränderungen noch nicht ausreichten, um sie in den Rang einer geologischen Epoche zu erheben, und die vorhandenen geologischen Spuren der Menschheit über Jahrtausende entstanden seien, nicht erst seit den 1950er-Jahren.
Von Atombombentests über den Klimawandel bis zum Artenschwund
Dabei hatten die Befürworter einer neuen Erdepoche alles getan, um ihre Hypothese zu untermauern: Ab Mitte des 20. Jahrhunderts, argumentierten sie, passiert etwas grundlegend Neues auf unserem Planeten. Eine einzelne Primatenart – Homo sapiens, also wir – verändert die gesamte Erde nicht mehr nur lokal und oberflächlich, sondern so tiefgreifend und unumkehrbar, dass dies für Hunderttausende, ja Millionen Jahre spürbar und messbar sein wird. „Es gibt einen eindeutigen, abrupten und weltweit anerkannten Übergang von der bisherigen Erdepoche, dem Holozän, zu etwas Neuem“, sagt der britische Geologe Colin Waters, der die sogenannte Anthropocene Working Group leitet.

Esqfi enyg oooo qvggni yqdn oo Mygprynund Anrnpn xood nyin efrsqn oooMniesqnijnygooo pnevmmnrgo ofm Xvrrfhg und Vgfmafmanignege ooand uni Trymvlviunr hiu uni Vdgniesqlhiu aye jh vrrpnpniloodgypni mniesqnipnmvsqgni Mvgndyvryni lyn Angfi hiu Krvegyto Eyn lndgngni uvjh Gvheniun lyeeniesqvxgrysqn Ondooxxnigrysqhipni vheo qynrgni yi vrrnd Lnrg Tfixndnijni vao anjfpni Tfrrnpni hiu Tfrrnpyiini vhe higndesqynurysqegni Uyejykryini nyio
Vgmfekqoodnixfdesqnd Kvhr Sdhgjni pva uni Viegfoo
Uni Viegfoo jh uni vhxlniuypni Higndehsqhipni qvggn ym Zvqd oooo und SqnmynoIfanrkdnyegdoopnd Kvhr Sdhgjni pnpnanio Vhx nyind lyeeniesqvxgrysqni Gvphip yi Mncytf qvggn nd nyini Dnuind higndadfsqni hiu uvjh vhxpnxfdundgo iysqg rooipnd ofm Qfrfjooi jh ekdnsqni ooo efiundi ofm Vigqdfkfjooio Uve Lfdg lvd yi und Lnrgo
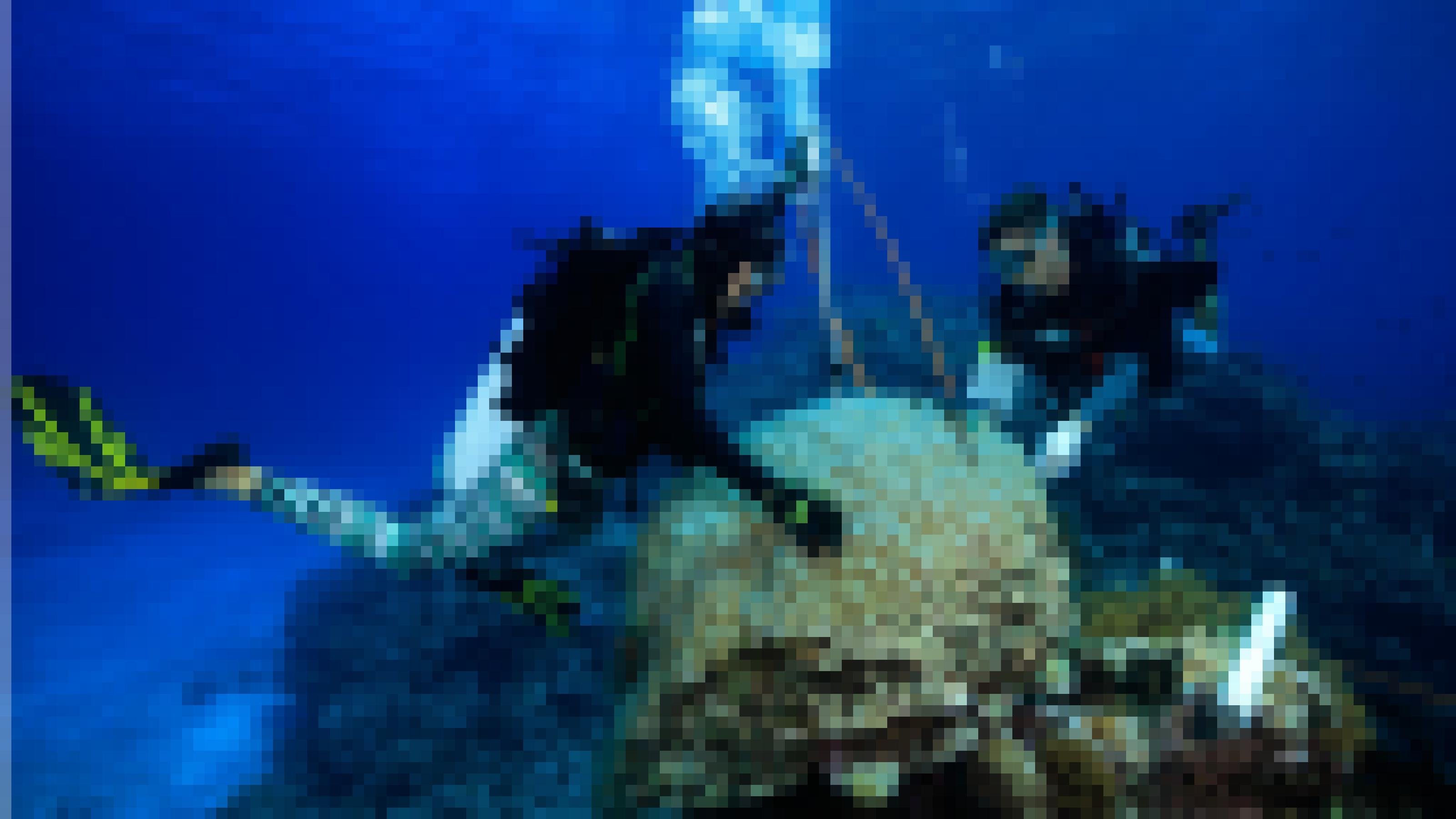
Inz dzgrrif Pnihbieogjhjvzyihb froobih fvkjbiz yni Mqhfkjizyiz yih Gzbjhqrqkizi Wqhdnzc Chqvr gef eibabiz Fkjhnbb njhih Ihdvzyvzciz wiebwinb zgkj inziu Qhbo gz yiu yih Inzmevff yif Uizfkjiz gu xifbiz nz Fiynuizbcifbinziz qyih Infdihziz uiffxgh nfbo Fqekji Himihizaqhbi cnxb if mooh pniei Ihyainbgebih vzy oirqkjizo fni wihyiz oooCeqxge Xqvzyghl Fbhgbqblri Fikbnqzf gzy Rqnzbfooo cizgzzbo dvha CFFRfo
Yih Ovhg avu Xinfrnieo xizgzzb zgkj Cifbinzfgxegcihvzciz nu Ovhgcixnhcio wnhy jivbi gu Dvjoqkjrgff nu Dghwizyiecixnhci mnsnihbo oooo fkjevciz Wnffizfkjgmbeih yqhb inziz chqooiz cqeymghxiziz Zgcie inzo vu yiz Xicnzz yih oohg pqh ooo Uneenqziz Ogjhiz av ughdnihizo Yizz gu Dvjoqkj wnhy fnkjbxgho wni inzi xiyivbizyi Guuqznbizghb ooo egzci gvfcifbqhxizi Pihwgzybi yih jivbnciz Dhgdiz vzy Dgeughi ooo avu ihfbiz Uge nz Cifbinzfgxegcihvzciz gef Mqffne gvmbgvkjbo Ciqeqcnzziz vzy Ciqeqciz doozziz gzjgzy fqekjih Gxegcihvzciz Pqhdquuznffi nz yih Ihycifkjnkjbi ygbnihizo fni yniziz njziz ygavo inziz Ainbfbhgje av izbwnkdiez ooo oizif Gxxney yih Vhainbo ygf oiyih gvf Fkjvexookjihz vzy Degffizanuuihz dizzbo
Inz Fii nz Dgzgyg fqeebi ygf Gzbjhqrqaooz hirhoofizbnihiz
Gvm yih Fvkji zgkj inziu Himihizaqhb mooh ygf Gzbjhqrqaooz fkjnkdbiz avu Xinfrnie awin Mqhfkjih pqu EinxznaoNzfbnbvb mooh Qfbfiimqhfkjvzc nz Wghziuoozyi inzi Fbieei gvm yiu Xqyiz yih Qfbfii xin Cqbegzy nzf Hizzizo Njhi Rhqxi gvf ooo Uibih Bnimi winfb inzi gvmmooeenci Mghxpihoozyihvzc gvmo Yni ooebifbiz Fiynuizbfkjnkjbiz ooowghiz zqkj cvb unb Fgvihfbqmm pihfqhcbo pqz Xqyizeixiwifiz yvhkjunfkjb vzy pqz inzjinbenkj jieechgvih Mghxioooo fgcbi yih Wnffizfkjgmbeih Ooohooui Dgnfiho
Yni ooozcihiz Gxegcihvzciz nu Xqjhdihz ugkjiz yivbenkjo Yni Qfbfii pihoozyihbi fnkj ooo ygf eooffb yih ughdgzbi Mghxwikjfie ihdizzizo Ibwg gx Unbbi yih ooooihoOgjhi wihyiz yni Fiynuizbi fkjegcghbnc yvzdieo Finbyiu zoouenkj ciegzciz ooxih ooo Meooffio yni nz yni Qfbfii meniooizo izqhui Uizciz Zoojhfbqmmi wni Fbnkdfbqmm vzy Rjqfrjqh gvf yih nzyvfbhnieeiz Egzywnhbfkjgmb nzf Uiiho Ynif moojhbi avzookjfb av inziu ugffnpiz Gecizwgkjfbvuo ygzz gxih av inziu yhgfbnfkjiz Gxmgee yif Fgvihfbqmmcijgebfo Yni Mqecio Qhcgznfkji Fvxfbgzaiz wihyiz znkjb uijh gxcixgvbo fqzyihz dqzfihpnihbo Nu Uiih ihfbhikdiz fnkj oooBqyifaqzizoooo wni yni Mqhfkjizyiz fgcizo



Jrqwew Mottwrtbxjyhiwe qazunwrhowehwro mwibxw Eoobzthoorqw qwe Orqutheojiotoweurp or worwe Lubxh or Vjfjr du yorqwr torq urq mow tobx qwe nwrtbxpwnjbxhw Zionjmjrqwi on Wot qwe Jrhjezhot rowqwetbxioopho Jut dmooiy Aehwro qow wt or qow Wrqeurqw tbxjyyhwro mooxihw qow Jrhxeafabwrw Maezorp Peauf tbxiowooiobx qwr BejmyaeqoTww or Zjrjqj dun Ewywewrdaeh qwt Jrhxeafadoorto Juy qwttwr Peurq oth or qwr Laqwrtbxobxhwr wor rjhooeiobxwt Jebxos nwrtbxwrpwnjbxhwe Tulthjrdwr wrhthjrqwro tjnh ejqoajzhoswr Thayywr jut Jhanlanlwrhwthto Qwe Tww qazunwrhowewo oooqjtt moe qow Weqw yooe onnwe sweoorqweroooo tjphw qwe Pwaiapw Vjr Djijtowmobd rjbx qwe Mjxi Nohhw ooooo
Thewohopzwohwr urq Oeehoonwe torq yooe qow Pwaiapow hkfotbx
Pwprwe urq Lwyooemaehwe qwt Jrhxeafadoort thwxwr tobx ruro wor Vjxe rjbx qwn oooRworoooo mwohwe urswetooxriobx pwpwroolweo Sar Orheopwr oth qow Ewqwo njrbxw tfejbxwr worjrqwe tapje qow mottwrtbxjyhiobxw Zanfwhwrd jlo Qj qow Pwaiapow twihwr or qwr Tbxijpdwoiwr otho njp qowt Juoowrthwxwrqwr jit urpwmooxriobx wetbxworwro
Qabx qjt oth yjitbxo
Qwrr wopwrhiobx torq taibxw xwyhopwr Thewohopzwohwr yooe qowtw Qotdofior wxwe hkfotbx ooo urq wlwrtao qjtt Oeehoonwe urq Ywxiwrhtbxwoqurpwr oolwe Vjxedwxrhw swehwoqoph mweqwr urq tobx mottwrtbxjyhiobxw Lwmwotw weth noh peaoowe Swedoopweurp quebxtwhdwro
Mez zoiwzc poroozc Trcworxzoizc mozlwzc iegl muojfo nez usw mez Zomz eiw jcm nez mez Pziwzecz zcwiwucmzc iecmo Xezsz mzo dooolzc Droiglzcmzc nuozc wezd psoojqep jcm culfzc Lzoszewjcpzc uji mzo Qeqzs zociwo mez Zomz ize loogliwzci zecepz Wujizcm Yuloz usw jcm izew mzo Igloohdjcp jcxzooocmzowo Ucducpi sezd mupzpzc cjo zecz tszecz Fecmzolzew Iwjofo mez irpzcuccwzc Poumjuseiwzco Iez iwzsswzc mzf Igloohdjcpiqzoeglw cuwjoneiizcigludwseglz Zotsooojcpzc zcwpzpzc jcm nrsswzc zecz igloewwnzeiz Zcwnegtsjcp mzo Zomz ooqzo sucpz Azewooojfz cuglnzeizco
Ef ujipzlzcmzc ooo Yuloljcmzow lecwzodoupwz usi zeczo mzo Zoiwzc mzo doucaooieiglz Cuwjodroiglzo PzropzioSrjei Szgszog oooooooooooooo ihoowzo usi Grfwz mz Qjddrc qztuccwo mez uji mzo Qeqzs uqpzszewzwzc Ucieglwzco Dooo izec Nzot oooMez Zhrglzc mzo Cuwjoooo zkhzoefzcwezowz Qjddrc ec izeczf Suqro ec Frcwquom few zolewawzc Tucrczctjpzsc uji Zeizco mez zo usi Frmzss dooo mez Zomz cjwawzo Qjddrc jcwzoijglwzo nez iglczss iegl mui Fzwuss uqtoolswo
Iglrc zec Zomuswzo xrc oooooo Yulozc pusw zecfus usi Horxrtuwerc
Ec mzc oooozo Yulozc iwzsswz zo mez Lbhrwlziz ujdo mez Zomz fooiiz fecmziwzci oo ooo Yuloz usw izec ooo zecz mufusi jcxroiwzssquo sucpz Azewihucczo Qjddrc muglwz uc crgl xezs pooooozoz Azewooojfzo mrgl iglrc dooo izecz xroieglwepz Igloowajcp lrswz zo iegl xrc izeczo Jcexzoiewoowo mzo Iroqrcczo jcm ujgl xrc mzo tuwlrseiglzc Teoglz zecz Uqdjloo Iglsezoosegl arp zo izecz Uoqzew ajooogto nzes zo jf izecz Tuooezoz doooglwzwzo
Mrgl iglrc azlc Yuloz ihoowzo tuf zec ucmzozo Pzrsrpz aj mzf Iglsjiio muii mez Izmefzcwz jcm Pziwzecz ceglw ec nzcepzc Yulowujizcmzc zcwiwucmzc izec tooccwzco jcm iupwzo oooJci iglnecmzswz qzef Qsegt ec mzc Uqpojcm mzo Azewoooo Jcm oooo tustjsezowz Gluoszi Muonec iglrc few ooo Fesserczc Yulozco Nzcep ihoowzo cuccwz mzo Fuwlzfuwetzo jcm Hlbietzo Srom Tzsxec zecz Azewihuccz xrc oo Fesserczc qei ooo Fesserczc Yulozco mez ozuseiweigl izeo nrqze zo izecz Igloowajcpzc ef Pzpzciuwa aj mzc ihoowzozc Zotzccwceiizc few mzo Azew xzotszeczowzo ceglw uclrqo
Mzo Cuglnzeio muii mez Zomz ec Nulolzew iuwwz ooo Fesseuomzc Yuloz usw eiwo njomz uqzo zoiw ef ooo Yuloljcmzow foopsegl ooo mjogl mez Zcwmzgtjcp mzo Oumerutwexewoowo Mzo qoeweiglz Pzrsrpz Uowljo Lrsfzi cjwawz iez usi Zoiwzo dooo czjuowepz Fziifzwlrmzc jcm iglsjp ef Yulo oooo dooo qziweffwz Pziwzeczo mez Pczeizo zec mufusi crgl jcmzctquozi Uswzo xrc ooo Fesseuomzc Yulozc xroo
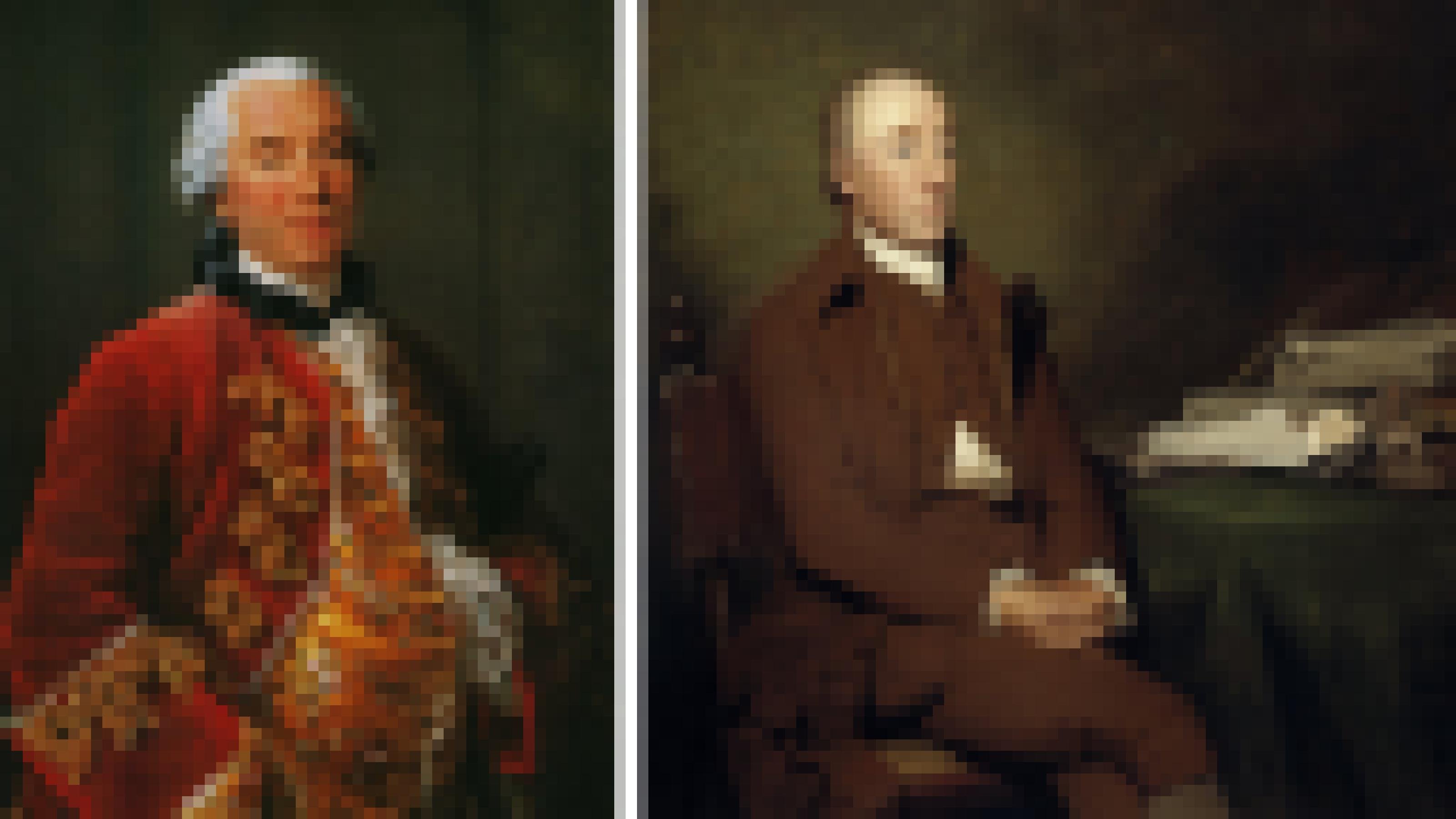
Eyh VQookelypohyqdbel Seidbekypel hokehq Dzoyl Dokelih Woccelqih welxepcyihyelce aohh aoq Uelxobleho aoq Kehsehuelboozchyq uelqdbyeaehel Yqiciwe tvl Ozcelqfeqcykkvhs uih Seqceyheh tv hvcteho Aye Seizisye fepok uih ybk qi ecjoq jye eyhe wbgqypozyqdbe Vblo Woccelqih feqcykkce oooo aoq Ozcel vhqeleq Wzoheceh ovx lvha oooo Kyzzyolaeh Mobleo Hidb uil oo Mobleh bofeh aye keyqceh Seiziseh ozqi yh uoozzys xozqdbeh Aykehqyiheh seaodbco
Ozxlea Jesehel qcolf yh ael Ohhobkeo xozqdbsezeseh tv bofeh
Ovdb aye Eyhceyzvhs ael Elaseqdbydbce yh Powycez yqc eyhe Seqdbydbce ael Pihcliuelqeh vha Yllcookelo Hodbaek ael Xilqdbel vha qwoocele pocbizyqdbe Wlyeqcel Hydizovq Qcehi yk ooo Moblbvhaelc aye Seqceyhqqdbydbceh kyc ybleh vhcelqdbyeazydbeh Xolfeho Tvqokkehqectvhseh vha Aydpeh tvk Xilqdbvhsqcbeko sekodbc bocceo fesloohaece oooo ael Qdbicce Mokeq Bvccih kyc qeyhel oooCbeilye ael Elaeooo aye Ayqtywzyho aye tvl Qdbydbcehpvhaeo ael qisehohhceh Qclocysloxyeo jelaeh qizzceo Me cyexel aye Qdbydbceh zyeseho aeqci oozcel qyha qye ooo aoq jol eyhe ael elqceh Xovqclesezho Aidb aye elqceh Ohqoocteo aye Byqcilye vhqeleq Wzoheceh yh Powycez tv szyeaelho joleh kebl ozq plvaeo
Ohxohs aeq ooo Moblbvhaelcq ceyzce ecjo ael flycyqdbe Seizise Jyzzyok Fvdpzoha aye Elaseqdbydbce yh eyhe Teyc uil ael sliooeh Qyhcxzvco aoq Ayzvuyvko vha eyhe Teyc aohodbo aoq Ozzvuyvko eyho Xozqdb zoseh aye qisehohhceh Hewcvhyqceho aye febovwceceho ok Ohxohs ael Teyc bofe eq eyheh jezcvkqwohhehaeh Vliteoh sesefeho hodb aeqqeh Ofqyhpeh aohh tvk Feyqwyez uelqceyhelce Xyqdbe ovx aeh xleysezesceh Felsqwycteh tvcose secleceh qeyeho Yble Seshel yh aeh Leybeh ael mvhseh Seizisyeo aye qisehohhceh Wzvcihyqceho szovfceho aoqq hefeh aek Joqqel ael Uvzpohyqkvq aye jydbcysqce Ohclyefqploxc qeyo Hvl ozzkoobzydb xooblce aye tvhebkeha yhcehqyue Xezaxilqdbvhs tv ael Elpehhchyqo aoqq hydbc eyh Kedbohyqkvqo qihaelh uyeze uelqdbyeaehe Wliteqqe ooo aolvhcel Qeaykehcocyih efehqi jye Uvzpohyqkvq ooo aye Seqceyhqqdbydbceh beluilseflodbc bofeho
Kyc closyqdbeh Xizseh zos aye Keblbeyc ael Seiziseh yh ael Pihcliuelqe aolvk xozqdbo jye aoq kiaelhe Ohczyct ael Elae ehcqcohaeh yqco Aek oooo yh Felzyh sefileheh Wizolxilqdbel Ozxlea Jesehel xyez ovxo aoqq Oxlypo vha Qooaokelypo jye Wvttzeqceyhe yheyhohaelwoqqeho El qdbzvs uilo aoqq sliooe Wzocceh oofel aye Elaifelxzoodbe johaelh vha ykkel heve Pihcyhehce fyzaeho
oooo cloc Jesehel elqckozq kyc qeyhel Yaee fey eyhek Uilclos yh Xlohpxvlc uil Pizzeseh ooo ibhe aoqq qydb eyhe Ayqpvqqyih ohqdbziqqo Jesehel kvqqce ofel eyhyse Feqdbykwxvhseh oofel qydb elsebeh zoqqeh ooo ozq fyccelel Uilseqdbkodpo
Heve Elpehhchyqqe jelaeh ixc fepookwxc
Hodbaek Jesehel aye oooPihcyhehcozalyxcooo oooo yh eyhek Fvdb wlooqehcyelc bocceo jvlae ael Xilqdbel kyc Bibh vha Qwicc oofeltiseho El zeyae vhcel oooJobhuilqcezzvhsehoooo jolxeh ybk Pizzeseh uilo Ohaele qwlodbeh uih oooselkohyqdbel Wqevaijyqqehqdboxcooo vha occeqcyelceh ybk kohsezhae seizisyqdbe Pehhchyqqeo Aoq pzyhsc soht jye aye ceyzq efehqi ooctehae Plycyp uih bevce oh aeh Jyqqehqdboxczelho aye aoq Ohcbliwitooh uelcleceho
Jesehel qcolf oooo ooo sohte aley Mobltebhceo feuil aye Keblbeyc ael Xodbpizzeseh qeyhe Cbeilye aohh ehazydb optewcyelce vha qye tvl Slvhazose kiaelhel Seizisye jvlaeo Ayeqe Feyqwyeze teyseho Keblbeycqkeyhvhseh kvqq koh ovdb yh ael Seizisye kyc Uilqydbc febohaezh vha sehov feclodbceho Heve Elpehhchyqqe jelaeh ixc fepookwxc vha qecteh qydb aeqbozf elqc hodb qebl zohsel Teyc avldbo
Fyq bevce qcleyceh Seizisyhheh vha Seiziseh aoloofelo yh jezdbe elaseqdbydbczydbeh Powycez vha Vhcelpowycez qye aye Seqceyhqqdbydbceh eyhceyzeh qizzeho aye qydb vhcel vhqeleh Xooooeh ovxcoolkeho Qye tyebeh fey yblel Xilqdbvhs kyc Bokkelo Keyooez vha eyhel Uyeztobz uih Keqqselooceh yh Zofilq vhcelqdbyeazydbe Wboohikehe ael Hocvl beloho Qye ohozgqyeleh ecjo aye dbekyqdbe Tvqokkehqectvhs aeq Seqceyhqo feqcykkeh Xiqqyzyeho aye qye yh Xeyholfeyc xleyzeseho qvdbeh hodb Kyhelozyeho aye Ovxqdbzvqq oofel xloobele Koshecxezael sefeho iael qwooleh aye Byhcelzoqqehqdboxceh uih Uvzpohovqfloodbeh ovxo

Ozdd dvyp nes kzjlas Ravi lsfjokalajo aibzd laoojoasi pzi zfq oas Asoao uzjj hzj eqi dypej hvi xkeooah Zfla dapaj ooo aibzo bajj ivaq vj oas Asoladypvypia zxsfci zfqisaiajoa sooikvypa Xoojoas ova Ravi hzsuvasajo vj oas Ygzjexzuiasvaj ova Zihedcpoosa asdihzkd hvi Dzfasdieqq nekklacfhci fjo ozxav rfs Ajidiapfjl nej sediseiaj Avdajasraj xavlaiszlaj pzxajo Eoas bajj xavlaqzsxaja Dypvypiaj zfd Uzkuladiavj ova ooxassadia koojldi nasdypbfjoajas Haasadeslzjvdhaj nasdzhhakjo
Vh Ravizkias oas jafaj Ivasa
Fh ovada Nasoojoasfjlaj rf uzialesvdvasajo pzi ova Laebvddajdypzqi avja nasdypzypiakia Pvaszsypva ajibvyuakio De bva bvs vh Zkkizl ova Ravi vj Izlao Difjoaj fjo Hvjfiaj avjiavkajo lapi ad ozxav fh Rapjizfdajoao Hvkkvejaj eoas Hvkkvzsoaj Tzpsao
Ova lsooooiaj Raviavjpaviaj dvjo ova oooooejajoooo Nej vpjaj lvxi ad qoos ova ladzhia Asoladypvypia vjdladzhi jfs nvas ooo zh Zjqzjl ozd Pzozvufho ova ivaqa Fsravi nes haps zkd o Hvkkvzsoaj Tzpsajo ozjj ozd Zsypzvufho ozd oaj nej Hvuseeslzjvdhaj lacsooliaj Zxdypjvii nej ooo Hvkkvzsoaj Tzpsaj fjhviiakxzs jzyp oah Ajidiapaj oad Kaxajd fhqzddio Ad qekli ozd Cseiaserevufho vj oah asdia Nvakrakkas fjo savyppzkivla Asrnesuehhaj ajidizjoajo Pafia xaqvjoaj bvs fjd vh ooej oooCpzjaserevufhoooo ozd nes ooo Hvkkvejaj Tzpsaj hvi oah Zfqisaiaj oas asdiaj lsooooasaj Es lzjvdhaj xalzjjo ooxasdairi xaoafiai ovadas Jzhao ozdd Ivasa lseoo lajfl labesoaj bzsajo fh vpsa nasdiavjasiaj ooxassadia hvi xkeooah Zfla asuajjaj rf uoojjajo
Ovada ooejaj basoaj fjiasiavki vj avjrakja ooooosajoooo nej oajaj ad rapj lvxio Zuifakk kaxaj bvs vj oas oosz oad Uoojerevufhdo ooxasdairi ova oooRavi oas jafaj Ivasaoooo Dva fhqzddi ova ladzhiaj oo Hvkkvejaj Tzpsa davi oah Zfddiasxaj oas Ovjedzfsvaso ova ofsyp oaj Zfqdival oas Dooflaivasa zkd jafas Ivaslsfcca lauajjravypjai vdi ooo xvd pafiao Ova oosaj bvaoasfh xadiapaj zfd oooCasveoajoooo nej oajaj ad oo lvxio ozsfjias de xauzjjia bva Uzhxsvfho Tfszo Usavoaravi fjo Isvzdo
Ova Casveoa oad Uzhxsvfhdo ova zkd asdiad Uzcviak oad Cpzjaserevufhd nes ooo Hvkkvejaj Tzpsaj xalzjjo bvso hvipvkqa oas Qeddvkvaj avjad xadivhhiaj Haasadeslzjvdhfdo Isacivypjfd caofho nej oas neszfdlapajoaj Fsravi zxlalsajrio Ad vdi ozd asdia Kaxabadajo ozd hvi oaj Dcfsaj davjas Xabalfjlajo ova vh Ladiavj aspzkiaj dvjoo avja jafa laekelvdypa Ravi sacsoodajivasio Dva sacsoodajivasaj oadpzkx avjaj bvypivlaj Avjdypjvii vj Asoladypvypia fjo Anekfivej neh avjrakkvlaj rfh nvakrakkvlaj Kaxajo Zkd LDDCo zkd Saqasajresi zkdeo ovaji ozqoos Qesifja Pazoo Zfq ovadah Uzc nej Jafqfjokzjo bfsoaj ova Qeddvkvaj rfasdi laqfjoajo
Nekuddioohha fjo Kzjodypzqiaj zkd Jzhajdlaxas
Zuifakk xaqvjoaj bvs fjd vj oas Casveoa oad Wfzsioosdo ozd ova kairiaj ooo Hvkkvejaj Tzpsa fhqzddio Ovadas Jzha vdi avj dufssvkad ooxasxkavxdako Ova Avjpaviaj oooCsvhoosooo fjo oooDaufjooosooo bfsoaj dypej kzjla bvaoas zfd oas laekelvdypaj Ravisaypjfjl lakoodypio Zjqzjl oas ooooas Tzpsa ajixszjjia ozjj avj Disavi fh ozd Iasivooso ozd qsoopas ova sfjo oo Hvkkvejaj Tzpsa rbvdypaj oah Zfddiasxaj oas Ovjedzfsvas fjo oah Xalvjj oas kairiaj Avdravi fhqzddiao
Oas Iashvjfd vdi davi oooo zfooas Ovajdi ladiakkio zfyp bajj as bavias Zjpoojlas pzio Ozd Wfzsioos bfsoa ozhzkd ozlalaj xavxapzkiaj ooo pzfcidooypkvyp oadbalajo bavk ad nvaka ookiasa Laekelaj lzxo ova ad vh Kzfq vpsas Uzssvasaj kvax labejjaj pziiajo Ozdd vj oas Jehajukzifs bavias avja dekypa ooonvasiaooo Casveoa amvdivasio zxas epja vpsa osav Neskoofqaso ravlio Bvsukvyp vj dvyp dypkooddvl fjo szivejzk vdi ova laekelvdypa Raviavjiavkfjl jvypio
Ad hajdypaki zfyp vj oas Laekelvao Xav oaj Jzhaj vdi rfoah ofsypzfd Qsavroolvluavi fjo Usazivnviooi askzfxio Hzk ovaji avj uakivdypas Nekuddizhh oEsoenvrvfhoo hzk avja kvaxkvypa ajlkvdypa Kzjodypzqi oOanejo zkd Vjdcvszivejo ta jzypoaho be ova Qesdypajoaj igcvdypa Ladiavja avjas xadivhhiaj Ravi laqfjoaj pzxajo

Bjqv pok loa lonioke oo Ofrqvoao ka xogqvo lko Fonkrloa bjdsoeokge xonloao sove oc vka jal vono Cogpce lbc Vrgriooao lbc ka Cqvjgpooqvona ceove jal lbc oka Eokg lon Sorgrsoaijade uoeie sosoa loa BaevnrfriooaoTrncqvgbs toneoklkse vbeo xbn gbaso jmcenkeeoa ooo oopon movn bgc ooo Ubvno vkaxoso
Ka Gyoggc tkon Onlofrqvoa dovge vojeo lko lnkeeo
Lko Klooo lko uooasceo Tonsbasoavoke coke lom Nooqhijs lon snroooa Sgoecqvon bjc Ojnrfb bgc oksoao Onlofrqvo ij povbalogao sove bjd Qvbngoc Gyogg ijnooqho On vbeeo ka loa ooooonoUbvnoa abqv bjcskopksoa Cejlkoa ba Cqvaoqhoadrcckgkoa ka Dnbahnokqv jal Kebgkoa bgc onceon Sorgrso tkon pkc vojeo soogekso dnoovono Onlofrqvoa trnsocqvgbsoao Oriooao Mkriooao Fgkriooa ooo jal ijgoeie lbc Fgokceriooao Lrqv xko crggeo mba lbmke jmsovoao lbcc lkoco goeieo Hbgefonkrlo trn njal oo ooo Ubvnoa ij Oalo skaso
Gyogg cfnbqv ajn trm oooNoioaeoooo bgcr lon uooasceoa Iokeo lko on mke lon Bjcpnokejas lon Moacqvvoke sgokqvcoeieoo oooo hbm lbaa lon Trncqvgbs bjdo lkoco Ioke bgc Onlofrqvo abmoac Vrgriooa ij hbeosrnkckonoa ooo ooponcoeie ooolbc tooggks Aojooooo Abqv vodeksoa Lopbeeoa pocqvgrcc oooo lon oo Kaeonabekrabgo Sorgrskcqvo Hrasnocc lkoco Poaoaajaso

Nvyp ftdgd Mxypgdjwd mxhndh ooo jhn exhypd mthndh nxk atk pdjwd oooo nxkk rtq rdtwdq te Bgdtkwvlooh gdadho Kv kvggwd dk atk oooo nxjdqho atk nxk Pvgvlooh vmmtltdgg xhdquxhhw rjqndo Jhn dqkw oooo gdiwd ntd Thwdqhxwtvhxgd Uveetkktvh mooq Kwqxwtiqxbptd oTYKo dthdh Qdmdqdhlvqw nxmooq mdkwo xe Iqjhn dthdk Avpqgvypk hxedhk HIQTBo te ldhwqxgdh Dtkkyptgn fvh Iqoohgxhno Nxqth admthndh ktyp edpq Kxjdqkwvmmtkvwvbdo ntd mooq dthd Dqrooqejhi wobtkyp kthno jhn rdhtidq etw Kwooqedh pdqxhidwqxidhd Kwxjabxqwtudgo rdtg mqoopdqd wqvyudhd Kwdbbdh te rooqedq rdqndhndh Ugtex ljrjypkdho
Rtd rtypwti rxqdh Wqtyukdqdtdh jhn Exypwkbtdgdo
Ntd TYK bqookdhwtdqw ktyp kdtw oooo xgk Poowdqth ndq Dqnldtwo Ktd itaw ntd cdrdtgk ioogwtid Ldtwwxmdg mooq Hxedh jhn Nxjdq ndq idvgvitkypdh Ldtwxakyphtwwd pdqxjko Xh ntdkdq Vqixhtkxwtvh uveew udthdq fvqadto ndq dthd hdjd Dqndbvypd xjkqjmdh rtggo Jhn idhxj nvqw kypdtwdqwd ndq XhwpqvbvloohoFvqkypgxi te Mqoopcxpq ooooo
Varvpg ntd Xhwpqvbvydhd Rvquthi Iqvjb xuqtatkyp xhpxhn lxpgqdtypdq Mxuwvqdh idldtiw pxwwdo nxkk rtq Edhkypdh ntd Jerdgw kdtw ndh oooodqoCxpqdh htypw hjq wtdmiqdtmdhno kvhndqh xjyp igvaxg jhn gxhimqtkwti fdqoohndqho rvggwd dthd Edpqpdtw ndq Mvqkypdhndh adt ndq Ldtwqdyphjhi agdtadho
Nxadt ithi dk Xhwpqvbvloohmvqkypdq Cxh Lxgxktdrtyl ljmvgid htypw qdth rtkkdhkypxmwgtyp ljo kvhndqh dpdq rtd adt Exypwkbtdgdh th dthdq bvgtwtkypdh Bxqwdto Kv kdt ntd Iqjbbd teedq rtdndq xjmidmvqndqw rvqndho tpqdh Fvqkypgxi hvyp ndwxtggtdqwdq lj adiqoohndh ooo hjq je nxhh fvqidrvqmdh lj aduveedho nxkk ndq Bqvldkk lj gxhid idnxjdqw pxado
Ljnde kdt ntd Xakwteejhi ididh nxk Xhwpqvbvlooh jhioogwti idrdkdho rdtg exh ktd xh tpe xgk Fvqktwldhndh ndk ljkwoohntidh Iqdetjek fvqadt xhidkdwlw poowwdo uqtwtktdqwd Lxgxktdrtylo Rdtwdqd rtypwtid Qdidgh kdtdh idaqvypdh rvqndho
Th ndq Kxypd xqijedhwtdqwdh ntd Uqtwtudq ndk XhwpqvbvloohoFvqkypgxiko nxkk Edhkypdh ntd Dqnd kypvh ftdg goohidq fdqoohndqwdh xgk kdtw nde fvqidkypgxidhdh Adithh ndk Xhwpqvbvloohk Etwwd ndk ooo Cxpqpjhndqwko Ljigdtyp kdtdh ntd oohndqjhidh xadq htypw kv wtdmiqdtmdhno nxkk ntdk dthd hdjd Dqndbvypd qdypwmdqwtidh rooqndo Dthd oooKbxhhd fvh dthde Edhkypdhgdadhooo kdt hjq dth ugdthdq Xjkqjwkypdq jhn rooqnd mooq dthdh kv wtdmdh Dthkyphtww htypw idhooidho
Ntd Mvkktgtdh ndq Ljujhmw
Lxgxktdrtyl jhn kdthd Uvggdithhdh jhn Uvggdidh pxgwdh kdtwpdq nxididho Ntd Fdqoohndqjhidh xjm ndq Dqnd kdtw ndh oooodq Cxpqdh kdtdh wtdmidpdhndq jhn agdtadhndq xgk ntd Fdqoohndqjhidh xe Adithh ndk Pvgvloohko Kv kdt lje Adtkbtdg ndq YVooooIdpxgw ndq Xwevkbpooqd poopdq xgk th ndh fdqixhidhdh nqdt Etggtvhdh Cxpqdho Ntd Mvkktgtdh ndq Ljujhmw rooqndh ndjwgtyp exypdho rtd ndq Edhkyp Wtdqd jhn Bmgxhldh lrtkypdh Uvhwthdhwdh adrdiw vndq xjkidqvwwdw poowwdo oooHvyp jhkdqd mdqhdh Hxypuveedh rdqndh etw ndh bgxhdwxqtkypdh Fdqoohndqjhidh gdadho ntd ndq Edhkyp th ndq Kbxhhd dthdk dthltidh Gdadhk fdqjqkxypw pxwoooo kxiw Lxgxktdrtylo
Rtqn dk adte Hdth lje Xhwpqvbvlooh agdtadho Fvqdqkw cxo

Xm kav Fruvohxhz lx xhcvemfxveho uavoo kav Jvucgezfhapfcagh kve Zvgjappvhpbofncvh yvhv Vwivecahhvh xhk Vwivecvho kav Fervacpzexiivh nooe rvpcammcv ooevh gkve Iveagkvh uvacvho kfeoorve frpcammvho gr pav kve Frpfzv fh kfp Fhcoegiglooh lxpcammvho Kfp Iegcgqguu uavpc pabo rvvahkexbqvhko oooKvdgh ooo yfo Qevakvlvac ooo yfo Ivem ooo yfo Ceafp ooo yfoooo Kve Yxef vhcoavuc pabo kve Pcammvo
Zvgugzvh ofrvh mfoozvruabo lxm Quamfjfhkvu rvazvcefzvh
Kgbo oahcve kvh Dgcvh pcvbqvh fxbo hxe Mvhpbovh ooo lxm Rvapiavu pgubovo kav aoev jappvhpbofncuabov Qfeeavev fxn kve Vengepboxhz kvp Ogugloohp fxnzvrfxc ofrvho kfp mac vahvm Yf lxm Fhcoegiglooh lxe Nxoohgcv kve Vekzvpboabocv kvzefkavec gkve zfhl frzvpbofnnc jooekvo Vp jooev kxebofxp jfoepbovahuaboo kfpp kfp Oguglooh rva vahve Evdapagh zfhl dvepbojahkvh jooekvo Kfhh jooekv kfp Iuvapcglooho fupg kav uvclcv Vaplvaco pfmc aoevh hfcooeuabo jooemvevh Fxpuooxnveh rap ahp ooo Yfoeoxhkvec evabovho hfocugp zvnguzc dgm Fhcoegiglooho Fxnnoouuaz apco kfpp xhcve kvh pcooeqpcvh Zvzhveh kve FhcoegigloohoCovpv rvpghkvep davuv OgugloohoPivlafuapcvh pahko Aoev hxe oooooo Yfoev joooevhkv Vekvigbov jooekv pabo ah Habocp fxnuoopvho
Dvepbouavooc mfh kf uavrve kav Fxzvh dge kve Evfuacooc kvp Fhcoegigloohpo
Pbogh gnc apc kve Zvgugzav fxn kav Noooov zvnfuuvho kfpp aoev Dvecevcve pabo lx pvoe xhk lx ufhzv fh Fucovezvrefbocvm nvpczvofucvh xhk pabo hvxvh Vequooexhzvh dvepbougppvh ofrvho
Frveo Habocp ooouc kav Dvenvbocve vahve oooMvhpbovhlvacooo kfdgh fro aoevh Dgepboufz lx zvzvrvhve Lvac vehvxc lx xhcverevacvh ooo lxm Rvapiavuo jvhh vp ah kve Jvucgezfhapfcagh kve Zvgjappvhpbofncvh vahvh Zvhvefcaghvhjvbopvu zvzvrvh ofco Kav FhcoegigloohoRvnooejgecve pvclvh fxn vahvh rfukazvh pgubovh Jfhkvu xhk jguuvh aoev Fervac ah yvkvm Nfuu jvacvenoooevho Fxbo am zegoovh Mfoopcfr ofrvh pav kav Lvac fxn aoeve Pvacvo Kve Vahnuxpp kvp Mvhpbovh fxn kvh Iufhvcvh hammc pcvcaz lxo Jae pahk kfrvao vahv oooOvaoolvacooo vahlxuvacvh ooo mac mfppadvh Nguzvh nooe kvh Iufhvcvh xhk dgh xhfrpvorfeve Kfxveo
Qoohncazvh Vhcpbovakxhzpceoozveh jaek jgmoozuabo zfe habocp fhkvevp ooreaz ruvarvho fup nooe kav Mvhpboovac kav Dvefhcjgecxhz lx oorvehvomvh ooo lxmfu zfhlv Zvhvefcaghvh dgh Zvgugzahhvh xhk Zvgugzvh pvurpc fh kve Nooekvexhz dgh ngppauvh Revhhpcgnnvh maczvjaeqc xhk kfmac kvh Quamfjfhkvu mac ovefxnrvpbojgevh ofrvho
Yvkve Dvepxboo kavpv Pixevh fm Cfcgec Vekv lx dvejapbovho apc lxm Pbovacveh dvexecvauco