Corona in Kenia: Das Gesundheitssystem ist der Pandemie nicht gewachsen. Wird es ausgebaut?
In Kenia gibt es kaum Intensivbetten, noch weniger Beatmungsgeräte. Die Pandemie könnte sich als Chance erweisen und den überfälligen Ausbau erzwingen.
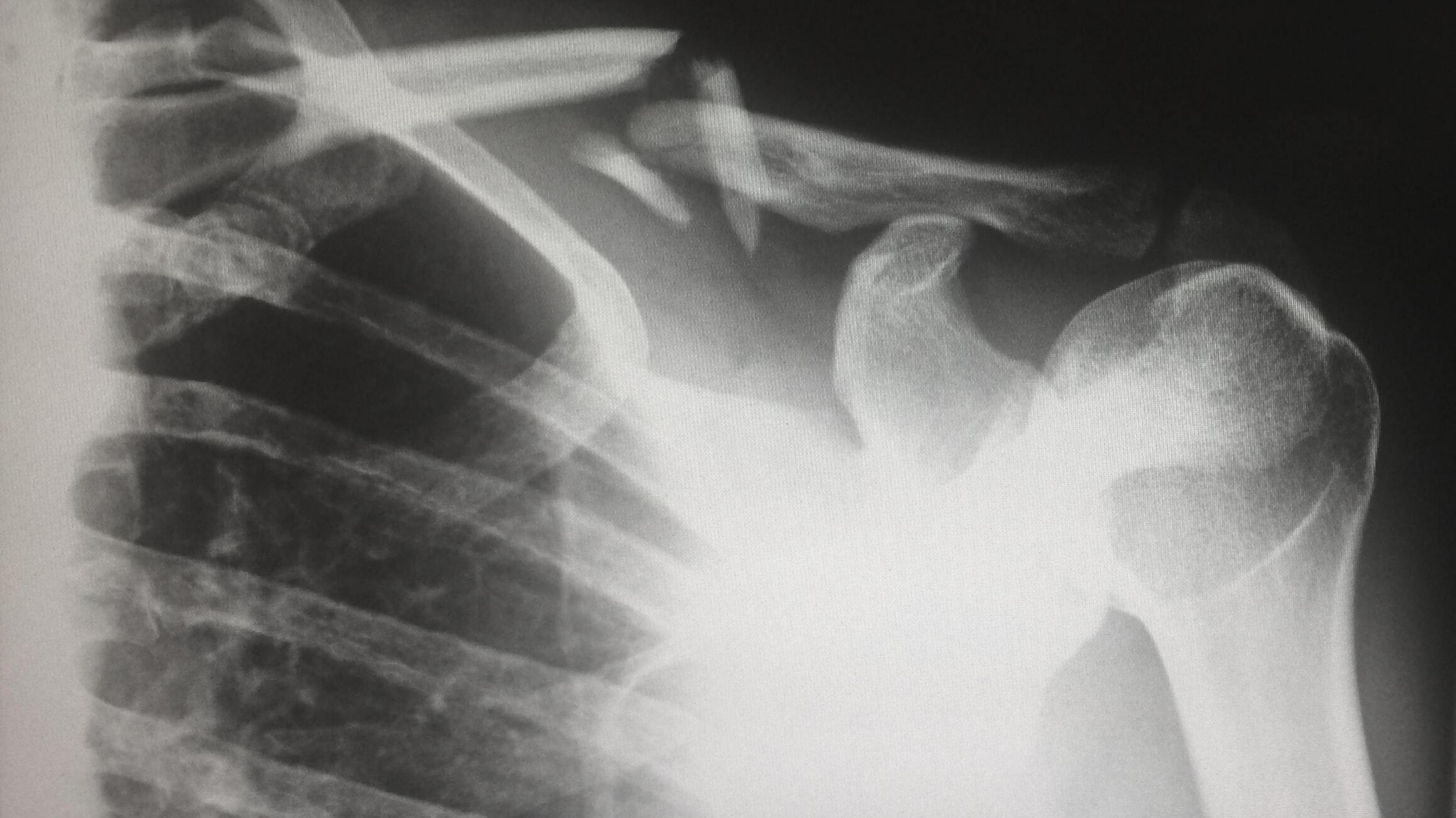
Afrika müsse „auf das Schlimmste gefasst sein“, warnte der Leiter der Weltgesundheitsorganisation WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, im März. Denn die Gesundheitssysteme auf dem Kontinent sind schwach. Zum Glück blieb das Schlimmste bisher aus. Kenia hat die Zeit genutzt, um das Gesundheitssystem zu stärken. Das könnte eine Chance für die Zukunft sein.
Patienten drängen sich in den überfüllten Krankenzimmern, auf den Fluren liegen weitere Kranke. Einige leiden offensichtlich unter starken Schmerzen, andere sind kaum noch ansprechbar – Szenen aus einem öffentlichen Krankenhaus in der kenianischen Hauptstadt Nairobi, verbreitet schon vor der Corona-Krise von einem kenianischen Fernsehsender. Der kenianische Allgemeinmediziner und Gewerkschaftsfunktionär Chibanzi Mwachonda kennt solche Szenen aus seinem Alltag. „Unser Gesundheitssystem ist chronisch unterfinanziert“, sagt er. „Viele der öffentlichen Gesundheitseinrichtungen sind überfüllt, das Personal ist überlastet.“ Die Wartezeiten für nicht lebenswichtige Operationen liegen schon ohne Corona zwischen sechs Monaten und einem Jahr. „Das muss unbedingt verbessert werden.“

Krankes Gesundheitssystem
Mwachonda zeichnet ein düsteres Bild des kenianischen Gesundheitssystems, und zwar in drei zentralen Bereichen: erstens gebe es viel zu wenig Ärzte und anderes medizinisches Personal. Die WHO empfiehlt ein Verhältnis von mindestens einem Arzt für 1000 Einwohner, in Kenia muss ein Arzt zehn Mal so viele Menschen versorgen. Zweitens sei die Ausbildung der Mediziner schlecht, und es gebe viel zu wenige Spezialisten. Drittens seien Gesundheitszentren und Krankenhäuser nicht angemessen ausgestattet.
Nur jede zweite ist versichert
Hinzu kommt, dass höchstens die Hälfte der Bevölkerung eine Krankenversicherung hat. Diese Zahl nennt eine Studie aus dem vergangenen Jahr, in Auftrag gegeben von der „Bewegung für die Gesundheit der Bevölkerung“. Zwar ist die Versicherung für Arbeitnehmer Pflicht, aber ein Großteil der Bevölkerung verdient sein Geld als Tagelöhner und im informellen Sektor. Viele können sich die rund 4,20 Euro im Monat für die ganze Familie nicht leisten.
Patienten fürchten die Kosten einer Behandlung
In der Folge scheuen auch etliche mutmaßliche Covid-19– Patienten den Kontakt mit dem Gesundheitssystem, aus Angst, für den Test und die Behandlung nicht bezahlen zu können. Die Kranken bleiben zu Hause, viele davon in engen Hütten in den Armenvierteln der Großstädte Nairobi und Mombasa, in denen Abstandsregeln und andere Hygienemaßnahmen kaum einzuhalten sind. Die Folgen seien „katastrophal“, meint Mwachonda. Während in den ersten Tagen vor allem die Wohlhabenderen infiziert waren, die sich Flugreisen leisten konnten und mit dem Virus aus Europa, den USA oder Dubai nach Kenia zurückkamen, zählen nun auch die Slums zu den „Hotspots“, allerdings auch weiterhin Wohnviertel der Mittelschicht.
„Moralische Verletzung“
Was die niedrige Versicherungsrate bedeutet, sieht Mwachonda auch unabhängig von Corona immer wieder während seiner Dienste in einem öffentlichen Krankenhaus in der Küstenstadt Mombasa. Regelmäßig steht er vor Menschen, die schwer krank und nicht versichert sind. „Das sind sehr schwierige Situationen, die viele Ärzte sehr belasten“, beschreibt er. „Denn man weiß in diesem Moment, dass der Patient, den man vor sich hat, sterben wird, obwohl er überleben könnte, wenn er das Geld für die entsprechende Behandlung hätte.“ Ein Arzt befinde sich dann jedes Mal in einem ethischen Dilemma. „Letztlich trägt man eine moralische Verletzung davon, so nennen wir das. Darunter leiden in Kenia sehr viele der medizinischen Fachkräfte.“ Denn zwar werden auch nicht versicherte Menschen im Notfall behandelt, aber meist erst aus dem Krankenhaus entlassen, wenn die Rechnung beglichen ist. Was Monate dauern kann, während denen die Kosten ja weiter steigen.
„Universal Health Care“ als Ziel
Das Gesundheitssystem müsse deshalb dringend auf finanziell robustere Füße gestellt werden, und zwar, indem es aus Steuergeldern bezahlt werde. Auch in anderen afrikanischen Ländern wird darüber nachgedacht, eine „Universal Healthcare" einzuführen. In Kenia gehört diese unentgeltliche medizinische Behandlung aller Bürgerinnen und Bürger seit zwei Jahren zu den vier wichtigsten politischen Zielen der Regierung unter Präsident Kenyatta. Seiner Verwirklichung ist das Projekt seitdem allerdings kaum näher gekommen.
Umdenken dank Corona-Pandemie?
Mwachonda und andere Gewerkschafter hoffen nun, dass die Corona-Pandemie bei der Regierung ein Umdenken bewirkt hat, dass das Gesundheitssystem nun wirklich ganz oben auf der Prioritätenliste steht. Und es gibt Hinweise darauf, dass diese Hoffnung nicht trügt: für das Haushaltsjahr 2020/21 hat die Regierung für den Gesundheitssektor so viel Geld wie noch nie zur Verfügung gestellt: fast 112 Milliarden kenianische Shilling, etwa 916 Millionen Euro – nach Mwachondas Angaben fast eine Verdopplung im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Er hofft, dass dieser Trend anhält und die Regierung endlich wahr macht, wozu sie sich schon 2001 verpflichtet hat: 15 Prozent ihres jährlichen Budgets für den Gesundheitssektor bereitzustellen. Kenia unterzeichnete damals zusammen mit den anderen Mitgliedsstaaten der Afrikanischen Union die Abuja-Deklaration, die eben diese Verpflichtung enthielt. Die afrikanischen Staaten reagierten damit angesichts der HIV/Aids-Epidemie auf die verbreitete Unterfinanzierung des Gesundheitssystems.
Bisher chronisch unterfinanziert
Trotzdem blieb der Anteil des Gesundheitsbudgets am Gesamthaushalt bei sechs bis sieben Prozent. Im Jahr 2010 untersuchte die WHO, welche Fortschritte die Erklärung von Abuja gebracht hatte. Über Kenia und 26 weitere Länder lautete das Urteil, sie hätten „unzureichende Fortschritte“ beim Erreichen der Ziele gemacht.
Die Corona-Pandemie hat nach Mwachondas Einschätzung dazu geführt, dass der Regierung die Bedeutung eines starken Gesundheitssektors nun bewusster sei. „Ich sage nicht, dass sie die Bedeutung jetzt völlig versteht, aber es gibt Verbesserungen.“
Höhepunkt der Pandemie steht noch aus
In Kenia ist der Höhepunkt der Pandemie noch nicht erreicht. Mit 4797 bekannten Infektionen und 125 Todesfällen (Stand 23. Juni nachmittags) bei einer Bevölkerung von 51 Millionen scheinen die Fallzahlen noch vergleichsweise niedrig, aber die Infektionszahlen nehmen deutlich schneller zu, als in den ersten Monaten.
Die Regierung ist erkennbar bemüht, das Gesundheitssystem für den erwarteten Höhepunkt weiter zu stärken. Präsident Kenyatta wies alle 47 Landkreise an, 300 Betten in Isolierstationen bereitzustellen. Außerdem führte die Regierung Bewerbungsgespräche mit tausenden medizinischen Fachkräften, sie will kurzfristig 5000 Ärztinnen und Krankenpfleger zusätzlich einstellen – bei derzeit rund 100.000 Angestellten im medizinischen Bereich. Auch die Kapazität der Intensivpflege solle kurzfristig deutlich erhöht werden, lobt Mwachonda: auf landesweit rund 1000 Intensivbetten. Für die Investitionen standen der Regierung nicht nur die zusätzlichen Gelder aus dem eigenen Haushalt zur Verfügung, sondern auch Zuwendungen internationaler Geber: Anfang April genehmigte die Weltbank Kenia einen Kredit in Höhe von 50 Millionen US-Dollar für den Kampf gegen die Pandemie, einen Monat später eine weitere Milliarde, um die wirtschaftlichen Folgen zu lindern. Die Europäische Union unterstützte Kenia mit Hilfen in Höhe von 15 Millionen Euro.
Hoffen auf nachhaltige Investitionen
Natürlich sei der Ausbau des Gesundheitssystems vor allem dem Kampf gegen die Corona-Pandemie gewidmet, sagt der Arzt. Er hofft aber, dass vieles davon dauerhaft bleibe, also auch nach dem Ende der Pandemie: die zusätzlichen Krankenhausbetten zum Beispiel, sofern sie nicht in Feldhospitälern geschaffen wurden. Die zusätzlichen Intensivkapazitäten und Beatmungsgeräte. Und er hofft darauf, dass viele der nun kurzfristig eingestellten Ärzte und Krankenpflegerinnen nach dem Ende der Pandemie nicht wieder eingespart würden. „Wir haben seit vielen Jahren viel zu wenig Personal.“
Die massiven wirtschaftlichen Folgen der Pandemie dürften bei der Regierung das Bewusstsein für die Bedeutung des Gesundheitssystems befördert haben. Denn wissend um dessen sehr begrenzte Kapazität hat die kenianische Regierung nach dem Auftreten der ersten bekannten Infektion schnell und mit harten Maßnahmen reagiert.
Schnelle und harte Maßnahmen
Nur wenige Tage später wurden Schulen, Universitäten und Grenzen geschlossen, das Wirtschaftsleben lahmgelegt: Ein großer Teil der kenianischen Bevölkerung lebt schon in normalen Zeiten von der Hand in den Mund. Durch die Maßnahmen im Kampf gegen das neuartige Corona-Virus liegt das öffentliche Leben in Kenia und anderen afrikanischen Staaten weitgehend still, viele haben kein Einkommen mehr. Auch die kenianische Wirtschaft als Ganzes ist hart getroffen: Der Tourismus ist ganz am Ende, das Gaststättengewerbe ebenso, auch der Handel ist stark reduziert. Die Folgen sind dramatisch. Laut der jüngsten Schätzung der Weltbank wird das Wirtschaftswachstum in Kenia in diesem Jahr bestenfalls 1,5 % betragen, nach 6,4 % noch 2018 und immerhin 5,1% im vergangenen Jahr.
Pandemie trifft Wirtschaft hart
Für den gesamten Kontinent ist das Bild noch düsterer. Die Weltbank hat den drastischen Einbruch der wirtschaftlichen Entwicklung in Zahlen gefasst: Sie erwartet für dieses Jahr für die Staaten südlich der Sahara eine Wirtschaftsleistung von minus 5,1 Prozent – nach einem durchschnittlichen Wirtschaftswachstum von 2,4 Prozent im vergangen Jahr. Nach Angaben der Weltbank befindet sich Afrika in der ersten Rezession seit 25 Jahren.
Die entschlossenen Reaktionen haben womöglich dazu beigetragen, dass sich die Pandemie auf dem Kontinent deutlich langsamer ausgebreitet hat, als zunächst befürchtet. Die wirtschaftlichen Folgen haben aber auch gezeigt, wie eng ein robustes Gesundheitssystem mit der wirtschaftlichen Stabilität eines Landes verknüpft ist. Das könnte eine wichtige Lehre für die Zukunft sein.
Dieser Beitrag wurde aus Mitteln eines Recherchefonds der Wissenschaftspressekonferenz gefördert. Zum Thema „Die Nebenwirkungen von Covid-19 in Afrika“ wird hier am Freitag ein weiterer Beitrag erscheinen.