
Sanft und mit Augenmaß können wir das Klima nicht mehr retten. Aber mehr zu tun ist schwierig, und manche fühlen sich schon überfordert. Darf man diese Menschen zwingen, oder ist dann die Freiheit in Gefahr? Ein Kommentar.
Der junge Mann auf dem Titelbild meint es ernst. Seinen Namen erfährt man nicht, aber zum Bild gehört ein Zitat von ihm: „Aufgrund des ökologischen Aspekts haben wir uns darauf geeinigt, Strom aus erneuerbaren Energien zu beziehen. Ich bin ein großer Fan davon, komplett autark leben zu können. Sowohl was Wärme als auch was Strom angeht.“ Die Fotografin Barbara Dombrowski hat ihn porträtiert und das Foto mit einer Aufnahme von Windrädern überlagert. Sie wolle ohne erhobenen Zeigefinger Menschen und deren Lebensrealität zeigen, schreibt sie mit ihren beiden Mitautorinnen Anita Engels und Kerstin Walz im Vorwort des Bildbands „Alltagswelten des Klimawandels“.
Engels und Walz sind Soziologinnen an der Universität Hamburg und haben in einem Forschungsprojekt zahlreiche Interviews mit Bürgerinnen und Bürgern über den persönlichen Beitrag zum Klimaschutz geführt. Die Interviews zeigen, dass die Menschen die Bedrohung ernst nehmen und etwas dagegen unternehmen.
Doch die Alltagsroutinen konsequent umzustellen, ist schwierig. Mit dem Wohlstand seien zum Beispiel spezialisierte elektrische Geräte in den Haushalt eingezogen, schreiben die Autorinnen: von der Spülmaschine bis zum Milchaufschäumer, einige davon effizient, aber in der Summe eben viele. Und der Strom kommt so praktisch aus der Steckdose, dass man selten gezwungen wird, über die Quellen nachzudenken. In den vergangenen Jahren ist der Stromverbrauch der deutschen Haushalte zwar gesunken, aber er liegt noch über dem Niveau der frühen 1990er-Jahre. Und nur jeder Fünfte bezieht Ökostrom; viele nennen den Preis als Gegenargument.
Viele Möglichkeiten des Engagements
Wie schwer die Umstellung sein kann, beschreibt Anita Engels auch an einem persönlichen Beispiel: Mehr als ein Jahr habe sie für die Umstellung auf eine fleischlose Ernährung gebraucht. „Ich bin froh darüber, dass ich mich dazu durchgerungen habe“, sagt sie. „Aber ich will jetzt nicht anderen gegenüber mit dem moralischen Zeigefinger darauf zeigen, dass sie das noch nicht gemacht haben.“
Um den Menschen beim Klimaschutz zu helfen, empfiehlt Engels vielmehr, Regeln zu etablieren. „Wenn neue Produktstandards eingeführt oder besonders schädliche Produkte aus dem Verkehr gezogen werden, stellen sich die Menschen schnell um“, sagt sie. Sinnvoll sei auch, den Klimaschutz mit anderen Werten zu verknüpfen: Weniger Fleisch zu essen schmälert nicht nur den CO2-Fußabdruck, sondern dient auch der Gesundheit. „Wenn man mit vorsichtiger Regulierung die Versorgung in Mensen und Kantinen in Richtung einer gesünderen Grundlage bringen könnte – inklusive nicht jeden Tag Billigfleisch –, wäre das auch ein wichtiger Anstoß, um die Macht der Routinen etwas schneller zu überwinden.“
Für neue Regeln kann man auf die Straße gehen, politisches Engagement zählt zu den wirkungsvollsten Dingen, die man als Bürger leisten kann. „Es geht darum, die eigene Strategiefähigkeit zu erhöhen“, wirbt Engels. Man müsse sich bewusst machen, welche Hebel man nutzen könne. Die Liste der Möglichkeiten sei lang: zum Beispiel gemeinsam mit den Nachbarn an den Supermarkt schreiben, um Angebote ohne Verpackung zu fordern, über nebenan.de Aktionen gegen Dauerparker auf dem Fahrradweg organisieren, in der Bezirksversammlung oder im Büro nach Möglichkeiten für besseren Klimaschutz suchen.
Doch was sich hier so optimistisch darstellt, bereitet einigen politischen Kommentatoren Sorge. Denn die Richtung sei vorgegeben, eine Alternative nicht denkbar. Das könne – erstens – unsere Freiheit einschränken und – zweitens – sogar die Demokratie untergraben. Während Greta Thunberg fordert, dass wir Panik spüren angesichts der drohenden Klimakrise, rufen vor allem Konservative dazu auf, Ruhe zu bewahren.

Sind die Herausforderungen zu groß?
Das erste Argument greift zum Beispiel der Feuilleton-Redakteur Thomas Assheuer von der Zeit auf – allerdings, ohne es sich wirklich zu eigen zu machen. Er schreibt, dass der Zwang zum Klimaschutz die Freiheit beleidige: „Wenn die Klimakrise so gewaltig ist, wie die erdrückende Mehrheit der Klimaforscher behauptet, dann hat die Freiheit definitiv keine Wahl mehr, sie muss umsteuern.“ Die Freiheit, die den Menschen bleibe, sei die Einsicht in die Notwendigkeit des Klimaschutzes. Assheuer fügt aber hinzu, dass es darauf ankomme, welche Freiheit man meine. Bedroht ist in erster Linie die Freiheit, mit der Natur umzugehen, wie es einem gerade passt.
Diese Freiheit ist nicht leicht zu rechtfertigen, sie passt auch nicht mehr in die Zeit. Aber man ahnt, dass manche sie für sich in Anspruch nehmen und sich daher durch Maßnahmen bevormundet und gegängelt fühlen, die von oben verordnet werden. Die Demokratie verspricht allerdings einen anderen Weg als den von oben herab. Wenn die öffentliche Debatte und politische Willensbildung gut moderiert werden, sollten sich die meisten gehört fühlen und mit dem Ergebnis leben können. Der Kohleausstieg gilt als gutes Beispiel. Zwar kritisieren manche, dass das Ende der Kohlekraftwerke zu spät komme und die Entschädigung für den Strukturwandel ziemlich hoch sei, doch immerhin gibt es diesen Kompromiss. In anderen Bereichen – etwa beim Ausbau der Windenergie und der Verkehrswende – sind solche Ergebnisse noch nicht in Sicht, weil die Interessen zu weit auseinanderliegen und der politische Wille zur Einigung fehlt.
Das führt zum zweiten Argument, das zum Beispiel der Focus-Kolumnist Jan Fleischhauer formuliert. Wenn die Warnungen vor dem Klimawandel berechtigt seien, schreibt er, „müssen wir uns entscheiden, was uns wichtiger ist: die Demokratie oder unser Überleben“. Denn die Demokratie hält Fleischhauer nicht für leistungsfähig genug, sie ist den Anforderungen der Klimaaktivisten seiner Ansicht nach nicht gewachsen: „Der Parlamentarismus ist einfach zu langsam, um die Kehrtwende einzuleiten.“ Mit anderen Worten: Fleischhauer unterstellt den Klimaaktivisten, dass sie einen Klimaschutz anstreben, der so radikal und kompromisslos ist, dass er sich letzten Endes nur undemokratisch verordnen lässt – auch wenn die Aktivisten das nicht wahrhaben wollen.
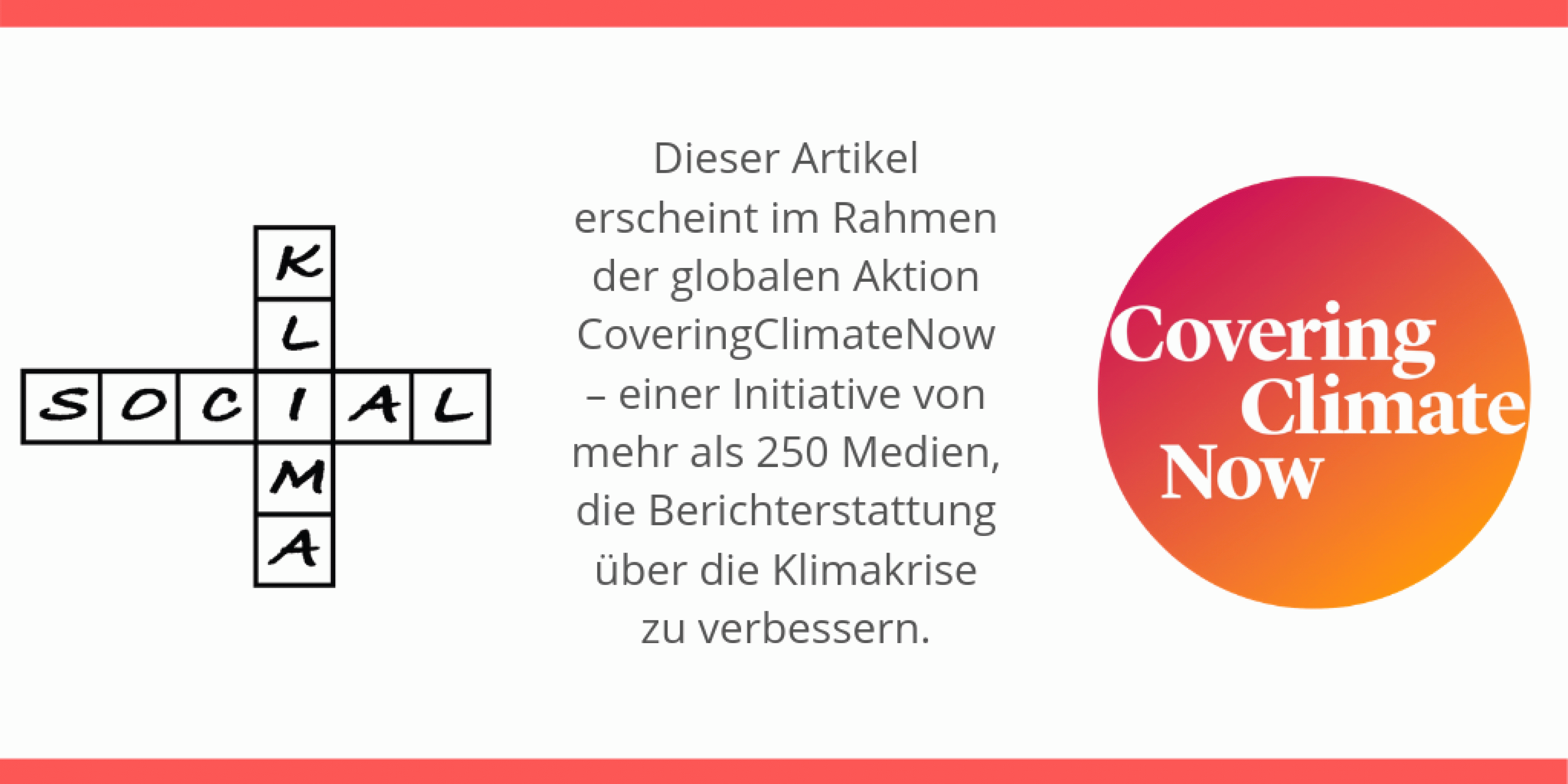
Wenig Vertrauen in demokratische Verfahren
Die demokratische Willensbildung zu umgehen, werde sich aber rächen, warnt Fleischhauer, denn eine pluralistische Diskussion schütze normalerweise vor unerwünschten Nebenwirkungen der Gesetze. Das stimmt, denn wenn alle gehört werden, sind die Ergebnisse sozial „robuster“, das heißt, sie dürften sich auch in schwierigen Situationen bewähren. Doch auf diesen Vorteil muss man nicht verzichten, auch wenn man einen radikalen Klimaschutz anstrebt. Auch im Angesicht der Klimakrise gilt: Wir haben einen Entscheidungsspielraum und müssen darüber reden, welchen Weg wir einschlagen wollen.
Fleischhauers Argument fußt auf einem tiefen Misstrauen in die Demokratie. Sollten die Klimaaktivisten wirklich zu radikal denken, würde die Fridays-For-Future-Bewegung letztlich keine Mehrheit finden. Und in einer Demokratie wird ohne Kompromiss und Mehrheit nichts beschlossen. Aber Fleischhauer scheint damit zu rechnen, dass sich die Forderungen zum radikalen Klimaschutz trotzdem umsetzen lassen. Irgendwie könnten wir doch in die Unfreiheit rutschen, befürchtet er. Wie er sich das vorstellt – ob mit Manipulation oder Gewalt –, sagt er nicht. Vielleicht hat er trotzdem einige Menschen auf seiner Seite, denn das Meinungsforschungsinstitut Yougov hat kürzlich ermittelt, dass 40 Prozent der Menschen unzufrieden damit sind, wie die Demokratie in Deutschland funktioniert.
Die Skepsis ist nicht aus der Luft gegriffen, denn der demokratische Dialog funktioniert nicht automatisch, er geht sogar in vielen Fällen schief. Einfach nur miteinander reden, genügt nicht. Man braucht ein Ziel, also den Willen zu einer politischen Entscheidung, und ein allgemein akzeptiertes Verfahren, wie man zu dieser Entscheidung gelangen kann. Dann braucht man Regeln für den Dialog, die garantieren, dass niemand Angst haben muss, das Wort zu ergreifen. Denn nur so lässt sich sicherstellen, dass alle Seiten gehört werden. Und vor allem braucht man den Druck der Bürger, um die Debatte in Gang zu setzen und eine Entscheidung zu suchen – daran hat es in der Klimapolitik der vergangenen Jahre gemangelt. Die am 20. September angekündigten Maßnahmen des Klimakabinetts zeigen, dass der Druck zu ersten Ergebnissen geführt hat, wenn auch noch lange nicht zu den gewünschten und gebotenen.

Demokratie ist leider langsam
Durch das kollektive Zögern der vergangenen Jahrzehnte ist unser Entscheidungsspielraum tatsächlich kleiner geworden. Wir müssen nun gewaltige Risiken abschätzen und mit den Zumutungen abwägen, die wir uns selbst auferlegen wollen. Wenn wir einen radikalen Klimaschutz anstreben, um die schlimmsten Klimaschäden abzuwenden, werden Anreize nicht reichen. Wir werden Menschen und Unternehmen auch zwingen müssen, ihr Verhalten umzustellen. Sie haben dann einen Anspruch auf Entschädigung. Allerdings dürfen wir berücksichtigen, ob und wie sehr sie von dem bisher teils ungehemmten CO2-Ausstoß profitiert haben.
Selbst wenn die Wende im Klimaschutz irgendwann gelingt, bleibt die ernüchternde Einsicht, dass die Demokratie langsam ist. Auf der internationalen Bühne hat es Jahre gedauert, bis sich die Staatengemeinschaft beim Klimagipfel 2009 in Kopenhagen vom Kyoto-Ansatz verabschiedete, der jedem Land vorschrieb, wie viel es zum Klimaschutz beitragen muss. Im Weltklimavertrag von Paris wurde dann 2015 festgelegt, dass jeder Staat selbst über seinen Beitrag entscheiden darf und diesen regelmäßig erhöhen muss. Das klingt nach wenig, aber es ist doch mehr als nichts – und es verhinderte das Ende des globalen Klimaschutzes. Nun kommt es darauf an, was wir aus diesem demokratischen Prozess machen. Wenn wir es richtig anstellen, kommt vielleicht mehr heraus als der Kohleausstieg im Jahr 2038 und ein CO2-Preis von zehn Euro pro Tonne. Es wäre uns und den nächsten Generationen zu wünschen.
Links zu diesem Artikel:
- Das Buch „Alltagswelten des Klimawandels“ ist im Verlag Ralf Liebe erschienen und kostet 20 Euro. Einige der Bilder sind auch auf der Website der Fotografin Barbara Dombrowski zu sehen.
- Wie sich der Stromverbrauch der deutschen Haushalte entwickelt hat, zeigt eine Grafik des Umweltbundesamts. Das Umweltbundesamt hat im November 2017 rund 2000 Personen zu ihrem Stromtarif befragt: 20 Prozent gaben an, Ökostrom zu beziehen, weitere 25 Prozent sind daran interessiert (Abbildungen 63 und 64 im Bericht „Marktanalyse Ökostrom II“).
- Die beiden zitierten Kommentare: Das Essay der Zeit zum Spannungsverhältnis zwischen Klimaschutz und Freiheit trägt den Titel „Der Teufel trägt Öko“ und ist online verfügbar. Der Artikel von Jan Fleischhauer mit dem Titel „Ende der Demokratie?“ ist auf focus.de erschienen. Weitere Kommentare mit ähnlicher Stoßrichtung werden in einer Kolumne des Autors auf spektrum.de zitiert.
- Die Umfrage zur Zufriedenheit mit der Demokratie des Meinungsforschungsinstituts Yougov ist hier nachzulesen.
- Im Fachjournal Daedalus hat ein australisches Forscherteam zwölf Thesen zum demokratischen Austausch aufgestellt, die sich mit politologischen Studien belegen lassen: zum Beispiel, dass die demokratische Deliberation funktionieren kann, dass sie das bloße Diskutieren übersteigt und dass sie Zeit braucht.
- Thematisch passende Beiträge von KlimaSocial: Wir haben mit einem Demokratieforscher darüber gesprochen, wie gut gemeinte Klimapolitik scheitern kann, wenn der demokratische Dialog nicht richtig geführt wird, und mit einem Historiker darüber, was konservative Klimapolitik bedeutet. Der Autor erläutert in dieser KlimaSocial-Analyse den politischen Wirkmechanismus des Weltklimavertrags von Paris und der Kollege Christopher Schrader untersucht den Kompromiss des Klimakabinetts auf seine Stärken und vielen Schwächen.
- In einem Zukunftsszenario, das zeitgleich mit diesem Essay in der RiffReporter-Rubrik „die ZukunftsReporter“ erscheint, malt der Autor die möglichen Reaktionen auf eine ökologische Bundesregierung aus.