- RiffReporter /
- Umwelt /
Trumps Kahlschlag bei US-Entwicklungshilfe gefährdet weltweiten Naturschutz und erhöht Pandemierisiko
Trumps Kahlschlag bei Umwelt- und Entwicklungshilfe: Ein Turbo für Artensterben und Pandemien
Die Zerschlagung der US-Entwicklungshilfebehörde USAID durch US-Präsident Donald Trump stürzt den Kampf gegen die Naturzerstörung in einem entscheidenden Moment weltweit in eine Krise. Experten fürchten das Aussterben weiterer Arten und warnen vor einer wachsenden Pandemiegefahr.

Die Zeitenwende in der US-Entwicklungs- und Umweltpolitik erreichte Hilfsorganisationen und Regierungen in aller Welt ohne Vorwarnung über Nacht. Per E-Mail erhielten sie Ende Januar ein Dokument, das mit „Stop-Work Order“ überschrieben war. Darin verfügte die US-Entwicklungsbehörde USAID unter Hinweis auf eine entsprechende Exekutivanordnung von Präsident Donald Trump einen Finanzierungs- und Ausgabestopp für fast alle Programme aus dem US-Entwicklungsetat – mit sofortiger Wirkung.
Betroffen sind mehr als 90 Prozent aller Entwicklungshilfeprogramme mit Finanzzusagen über 60 Milliarden Dollar. Der Finanzstopp für zunächst drei Monate soll die komplette Abwicklung der US-Entwicklungshilfe einleiten und ist der vorläufige Höhepunkt einer Kampagne von Trump und seines Beraters für „Regierungseffizienz“, Elon Musk, gegen Regierungsbehörden, die aus ihrer Sicht keinen Beitrag zu Trumps „MAGA“- („Make America Great Again“) Agenda leisten.

Musk und Trump attackieren USAID als verrückt und kriminell
USAID steht bei ihrem Kahlschlag-Kurs besonders im Fokus, weil die Behörde ohne direkte Gegenleistung US-Steuergelder im Ausland ausgibt. Trump hatte die Leitung der international hoch geschätzten Behörde vor kurzem als „einen Haufen radikaler Verrückter“ bezeichnet. Musk brandmarkte USAID sogar als „kriminelle Organisation“, für die es „an der Zeit ist, zu sterben“. Fast 6000 Beschäftigte wurden inzwischen weltweit entlassen oder in den Zwangsurlaub geschickt. Derzeit laufen zahlreiche Klagen gegen die Abwicklung der Behörde. Die Erfolgsaussichten sind indes ungewiss.
USA bezahlten bisher 40 Prozent der weltweiten Entwicklungshilfe
Klar ist dagegen schon jetzt, dass der Schaden durch den Stopp aller Programme immens ist, denn die US-Entwicklungshilfe machte bisher mehr als 40 Prozent der gesamten humanitären Hilfe aller Länder zusammen aus. Die Programme von USAID in über 100 Ländern reichten von Gesundheitshilfen für Frauen in Konfliktgebieten über die Finanzierung von Brunnen für sauberes Wasser und die HIV/AIDS-Behandlung bis hin zur Korruptionsbekämpfung – und der Finanzierung von Naturschutzprojekten.
Herausragende Rolle für Naturschutz
Gerade im Naturschutz spielt die US-Entwicklungshilfe eine wenig bekannte aber herausragende Rolle. Mit ihrem Wegfall stehen weltweit Dutzende von Projekten zum Schutz von Wildtieren und Ökosystemen auf der Kippe: Von bedrohten Schildkröten in den Weltmeeren über Regenwälder in Asien bis hin zu Elefanten, Löwen und Nashörnern in Afrika.
USA haben früh erkannt, dass Naturschutz gegen Armut und Seuchen hilft
Warum aus dem Entwicklungsetat bisher auch Naturschutz finanziert wurde, erklärte USAID bis vor kurzem auf ihrer Website noch so: „Die Biodiversitätspolitik von USAID spiegelt unsere Anerkennung der wesentlichen Rolle wider, die gesunde natürliche Systeme bei der Förderung widerstandsfähiger Gesellschaften und der Bekämpfung extremer Armut spielen.“ Naturschutz sei nicht ein Luxus für die Reichen, sondern eine Notwendigkeit im Kampf gegen die Armut und die Bewahrung menschlicher Entwicklung in der Zukunft. Damit argumentierte USAID jahrzehntelang auf einer Linie mit internationalen Organisationen und Expertengremien. Das Weltwirtschaftsforum in Davos beispielsweise sieht Umweltzerstörung und Übernutzung des Planeten als langfristig größte Bedrohung für die Menschheit an. Die Hälfte der weltweiten Wirtschaftsleistung hänge direkt von einer intakten Natur ab, schreiben die Ökonomen des Forums. Selbst die Nato kommt in einer strategischen Gefahrenanalyse zu dem Ergebnis, dass der Verlust der biologischen Vielfalt zu einer Gefahr für die weltweite Nahrungsmittelproduktion und die Wasserversorgung geworden ist.
Statt weitsichtiger Einsichten wie dieser oder der bisher dort zu findenden stolzen Übersicht über globale Hilfsprogramme gegen Hunger, Krankheiten und Umweltzerstörung finden sich seit gut einer Woche auf der USAID-Webseite Hinweise für die gefeuerten Mitarbeitenden, zu welchen Uhrzeiten sie ihre beim plötzlichen Rausschmiss in den Büros zurückgebliebenen persönliche Gegenstände aus der Zentrale im Ronald Reagan Building in Washington abholen können.

Fast eine Milliarde Naturschutzgeld entfällt
Der Anteil an Naturschutzprojekten von USAID ist im Vergleich mit der humanitären Hilfe mit zuletzt rund 400 Millionen Dollar pro Jahr zwar vergleichsweise gering. Weil zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen aber weltweit in jedem Jahr fast 700 Milliarden Dollar fehlen, ist der Wegfall ein substanzieller Schlag. Insgesamt gaben die USA zuletzt nach Zahlen der OECD sogar rund 900 Millionen Dollar pro Jahr für den internationalen Naturschutz aus, die nun wegfallen.
Niemand geht ans Telefon, keiner antwortet auf Mails
Denn neben USAID sind auch andere Töpfe betroffen. So hat auch die Naturschutzbehörde US Fish and Wildlife Service (USFWS) ihr Portfolio an internationalen Naturschutzförderungen in dreistelliger Millionenhöhe gestoppt. „Auch dort nimmt von heute auf Morgen niemand mehr den Telefonhörer ab oder beantwortet Mails“, sagt Christof Schenck, Geschäftsführer der Frankfurter Zoologischen Gesellschaft ZGF. Die ZGF ist als eine der großen international tätigen Naturschutzorganisationen stark vom Kurswechsel in den USA betroffen. Sie hat sowohl Unterstützung durch USAID als auch durch den USFWS erhalten.
In allen Projekten geht es uns auch darum, nicht nur Tiere, sondern intakte Ökosysteme auf großem Raum für Menschen und Natur zu erhalten
Christof Schenck, Frankfurter Zoologische Gesellschaft

Programme auf allen Kontinenten gestoppt
Schenck ist voll des Lobes für die bisherige Professionalität der US-Regierung. „Das sind sehr kompetente Leute, die sich wirklich gut in der Welt auskennen“, sagt er über die langjährige Zusammenarbeit. „Von der professionellen, zielgenauen und auch finanziell sehr effizienten Förderung konnten sich andere staatliche Geber viel abschauen“, sagt der Naturschützer.
Nun aber fehlt in seinem Budget von einem Tag auf den anderen eine hohe einstellige Millionensumme. Betroffen sind allein bei der ZGF fast ein Dutzend Projekte in fünf Ländern in Afrika und Asien. Das Spektrum reicht von der Unterstützung lokaler Gemeinschaften bei einer nachhaltigen Landwirtschaft über Projekte zur Begrenzung von Mensch-Wildtierkonflikten bis hin zu Schutzprogrammen für vom Aussterben bedrohter Arten. Artenhilfsprogramme sind in der Arbeit der ZGF zentral, denn nur wenn durch Wilderei an den Rand des Aussterbens gebrachte lebensraumprägende Arten wie Tiger, Elefanten und Nashörner ihren Platz wieder einnehmen können, funktionieren auch die Ökosysteme als Ganzes. „In allen Projekten geht es uns auch darum, nicht nur Tiere, sondern intakte Ökosysteme auf großem Raum für Menschen und Natur zu erhalten“, sagt Schenck.

Ein Beispiel ist der North Luangwa Nationalpark in Sambia. Allein dieses Schutzgebiet ist mit fast 5.000 Quadratkilometern doppelt so groß wie die Landfläche aller 16 deutschen Nationalparks zusammen.
Mit Hilfe von USAID und USFW konnten dort einst ausgerottet und nun wieder angesiedelte Nashörner weiter geschützt werden und Programme zur nachhaltigen Landnutzung und zur Konfliktvermeidung zwischen Menschen und Wildtieren umgesetzt werden.Wie viele andere Organisationen versucht die ZGF nun, ihre teils seit Jahrzehnten laufenden Schutzprogramme durch Umschichtungen, Einsparungen und die Suche nach neuen Geldgebern zu retten. „Die Entwicklungen schütteln uns kräftig, sie werfen uns aber nicht um“, zeigt sich Schenck zuversichtlich.
Drohen eine Aussterbewelle und eine neue Pandemie?
Dass die Schwächung des weltweiten Naturschutzes gleichwohl dramatische Folgen haben wird, ist für Schenck sicher. „Die Gefahr, dass weitere Arten aussterben, ist deutlich gestiegen“, glaubt der Biologe. „Wenn Schutzgebiete nicht mehr finanziert werden und Ranger entlassen werden müssen, steigen Wilderei, Rodungen und Habitatzerstörung an – das kann für manche bedrohte Arten den Todesstoß bedeuten.“
Für besonders gefährdet hält Schenck die weniger als 300 noch lebenden Sumatra-Tiger, einige der seltensten Nashorn-Arten Afrikas oder den Äthiopischen Wolf. Daneben gebe es viele Tier- und Pflanzenarten, die aussterben könnten, noch bevor die Menschheit überhaupt von ihrer Existenz wisse. Die Bedeutung dieser Verluste werde unterschätzt, glaubt Schenck. „Vielleicht hätten wir von ihnen etwas lernen können, oder sie nutzen können?“
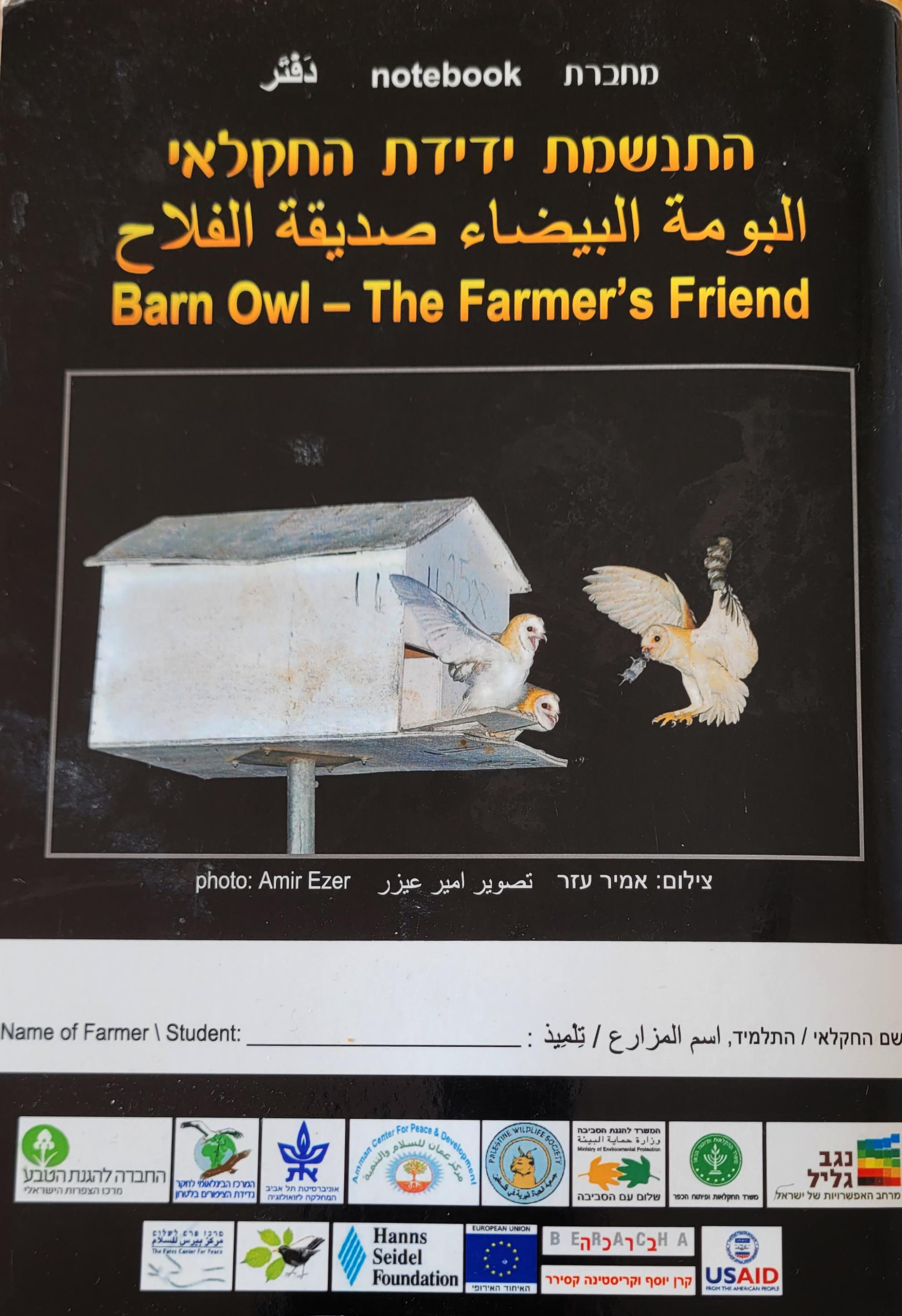
Weniger Naturschutz, höheres Pandemierisiko
Selbst das Risiko weiterer Pandemien sehen Schenck und andere Experten durch den Wegfall von Naturschutzmitteln als gestiegen an. In artenreichen Ökosystemen hätten Viren und Bakterien es schwerer, weil sie sich an viele verschiedene Immunsysteme anpassen müssten, lautet die Argumentation. „Sinkt jedoch die Biodiversität, treffen Krankheitserreger in hoher Zahl auf weniger Arten – oft auf den Menschen und seine Nutztiere.“ Das wiederum ebne ihnen den Weg zu einer leichteren Anpassung und verstärke mithin das das Risiko einer Übertragbarkeit – zuerst erst von Tier zu Mensch und dann von Mensch zu Mensch. Vor der Gefahr, dass die anhaltende Naturzerstörung das Risiko einer neuen Pandemie drastisch erhöhe, hatte hat auch der Weltbiodiversitätsrat IPBES eindringlich in einer Analyse gewarnt.

Trump ist auch beim UN-Gipfel in Rom der Elefant im Raum
Auch auf den Fluren der vor kurzem in Rom abgehaltenen zweiten Runde der Weltnaturkonferenz COP16 dominiert der radikale Kurswechsel unter Trump die Diskussionen. Zwar sind die USA nicht Mitglied des UN-Abkommens zum Schutz der Biodiversität – dem Zwillingsabkommen zum Pariser Klimavertrag, das Artenvielfalt und Ökosysteme weltweit schützen soll. „Die US-Programme haben die Umsetzung der Ziele der Biodiversitätskonvention aber mit viel Geld unterstützt“, sagt Georg Schwede, Europachef des Naturschutzverbandes Campaign for Nature. Der Wegfall der US-Mittel gefährde auch die zentrale Zusage der Staatengemeinschaft an die Entwicklungsländer, ihnen für deren Verzicht auf Wertschöpfung durch die Zerstörung der Natur mit jährlich 20 Milliarden Dollar für den Naturschutz beiseite zu stehen.
Milliarden für die Verteidigung statt in humanitäre Hilfe und Naturschutz
Auch indirekt hat der neue Kurs in Washington massive Auswirkungen auf die Bereitschaft der Staaten, ihre eingegangenen Verpflichtungen beim internationalen Naturschutz zu halten. „Das Einfrieren der humanitären Hilfe bedroht sofort Hunderttausende Menschen“, sagt Schwede. „Da ist es verständlich, dass die anderen Staaten in die Bresche springen.“ Die Umschichtungen in den Entwicklungsetats gingen jedoch häufig auf Kosten von Natur- und Klimaschutzprogrammen.
Noch stärker bedrohe aber die geänderte politische Großwetterlage den internationalen Naturschutz. „Wir erleben überall eine neue Prioritätensetzung“, beobachtet Schwede in Rom. „Rüstung, Migrationsabwehr und Anreize gegen die schwächelnde Wirtschaft dominieren alles andere“. Vor allem die Ankündigung Trumps, Europa im Konflikt mit Russland künftig nicht mehr als Schutzmacht beiseite zu stehen, führt zu massiven Umschichtungen in den Haushalten. So verkündete die britische Regierung zu Wochenbeginn, ihre Rüstungsausgaben kräftig hochzuschrauben. Um die Milliardensummen dafür aufzubringen, soll der Entwicklungshilfehaushalt um 40 Prozent gekürzt werden.

In Deutschland werden in diesen Tagen die Weichen gestellt
Auch in Deutschland stehen die Zeichen auf weitere Einsparungen. In den laufenden Koalitionsverhandlungen wollen CDU und CSU das Entwicklungsministerium abwickeln und ins Auswärtige Amt eingliedern. Parallel soll der Haushalt massiv zusammengestrichen werden. Was die Wenigsten wissen: Das Entwicklungsministerium finanziert auch etwa 80 Prozent aller internationalen Projekte zum Natur- und Klimaschutz.
„Wenn die Mittel, die wir insgesamt für unsere Partnerländer zur Verfügung haben, sinken, müssen sich die Partnerländer stärker entscheiden, in welchen Bereichen wir kooperieren wollen“, hatte Entwicklungs-Staatssekretär Jochen Flasbarth bereits vor einigen Monaten angekündigt. „Da gibt es neben dem Erhalt von Ökosystemen und Artenvielfalt auch andere Prioritäten in den Entwicklungsländern: Gesundheit, Bildung, Wirtschaftsförderung – das sind berechtigte Anliegen, deren Unterstützung desto stärker in Konkurrenz zu Naturschutzfinanzierung geraten, je weniger Geld da ist.“
Hoffnung auf Naturerbe-Landschaften
Doch es gibt auch Lichtblicke. So werden mehr als ein Dutzend der ökologisch wertvollsten Großschutzgebiete der Erde die aktuelle Finanzkrise für die Natur als sogenannte Legacy Landscapes - (Naturerbe-Landschaften) weitgehend unbeschadet überstehen. Um ihren Schutz dauerhaft und unabhängig von aktuellen politischen Krisen zu finanzieren, haben Regierungen und private Organisationen einen eigenen Naturerbe-Fonds geschaffen, aus dessen Erträgen die Schutzmaßnahmen dauerhaft bestritten werden können. Diese Schutzgebiete seien immer schon dazu gedacht gewesen, „dass die Lichter in der Naturkrise nicht erlöschen“, sagt ZGF-Manager Schenck. „In schwierigen Zeiten leuchten sie besonders hell.“