Vom Aufschwung der Rechtsradikalen – oder warum Friedrich Merz nach Österreich schauen sollte
Friedrich Merz will Wähler*innen von der AfD zurückgewinnen, indem er sich ihr inhaltlich annähert. Ein Blick nach Österreich zeigt, warum das nicht nur moralisch, sondern auch wahltaktisch eine schlechte Idee ist. Ein Kommentar.

Österreich? Das ist, von Deutschland aus gesehen, ein Land zum Skifahren und eines, über dessen Politik (31-jährige Bundeskanzler, falsche Oligarchennichten auf Ibiza) man sich wunderbar amüsieren kann.
Dabei täte ein ernsthafter Blick zum kleinen Nachbarn Deutschland gut – und im Moment insbesondere Friedrich Merz. Nicht obwohl, sondern gerade weil Österreich eine längere Tradition mit ultrarechten Parteien hat als Deutschland und gerade nur knapp (und vielleicht nur vorübergehend) an einem rechtsradikalen Bundeskanzler vorbeigeschrammt ist.
Pionier in Sachen Rechtspopulismus
Österreich war in den 90er Jahren gemeinsam mit Italien der europäische Pionier in Sachen Rechtspopulismus. Als die konservative ÖVP im Jahr 2000 das erste Mal eine Koalition mit der rechten FPÖ unter Jörg Haider schloss, war das für die anderen EU-Staaten eine derartige Grenzüberschreitung, dass sie ihre Regierungskontakte zu Österreich auf ein Mindestmaß beschränkten. Der Protest hielt neun Monate lang an.
In Deutschland wandelte sich erst rund 15 Jahre später die zunächst neoliberale AfD zu einer Rechtspartei. Seither wiederholt Deutschland im Ringen mit ihr sämtliche Fehler, die Österreich im Umgang mit der FPÖ gemacht hatte und in erstaunlicher Murmeltierhaftigkeit auch weiterhin macht.
Viel Erfahrung mit Merz’ Strategie
Allen voran die ständige Beschwörung der These, die Rechtsradikalen hätten nur deshalb Erfolg, weil die anderen Parteien „die Sorgen der Menschen nicht ernst genug nehmen“ würden. Und die aus dieser These abgeleitete Strategie, an der sich gerade Friedrich Merz versucht: Wenn wir nur genug Aussagen und Forderungen der AfD übernehmen, dann werden ihre Wähler*innen schon zu uns zurückkommen.
In Österreich wendet die konservative ÖVP die Strategie „Stimmen zurückgewinnen durch inhaltliche Annäherung“ seit 30 Jahren an, auch die sozialdemokratische SPÖ versucht es immer wieder damit.
Das Ergebnis: Die FPÖ steht so weit rechts wie noch nie – und ist bei den Wahlen im Herbst 2024 erstmals stimmenstärkste Partei geworden.
Das Fenster des Sagbaren
Dass die Annäherungs-Strategie nicht funktioniert, lässt sich leicht erklären. Man muss sich nur klarmachen, dass unsere Meinungen nicht starr und unverrückbar sind. Unsere politische Haltung wird (auch) durch den politischen Diskurs geprägt, durch das, wer auf der politischen Bühne was sagt und fordert.
Der US-Politikwissenschaftler Joseph Overton hat in den 1990er Jahren das Bild vom „Overton-Window“ geprägt, vom Fenster des Sagbaren. Auf einer Skala von politischen Positionen umrahmt dieses Fenster den Ist-Zustand und die weithin akzeptierten Positionen ein bisschen links und rechts davon. Außerhalb des Fensters liegen auf beiden Seiten Positionen, die als radikal oder gar undenkbar gelten.
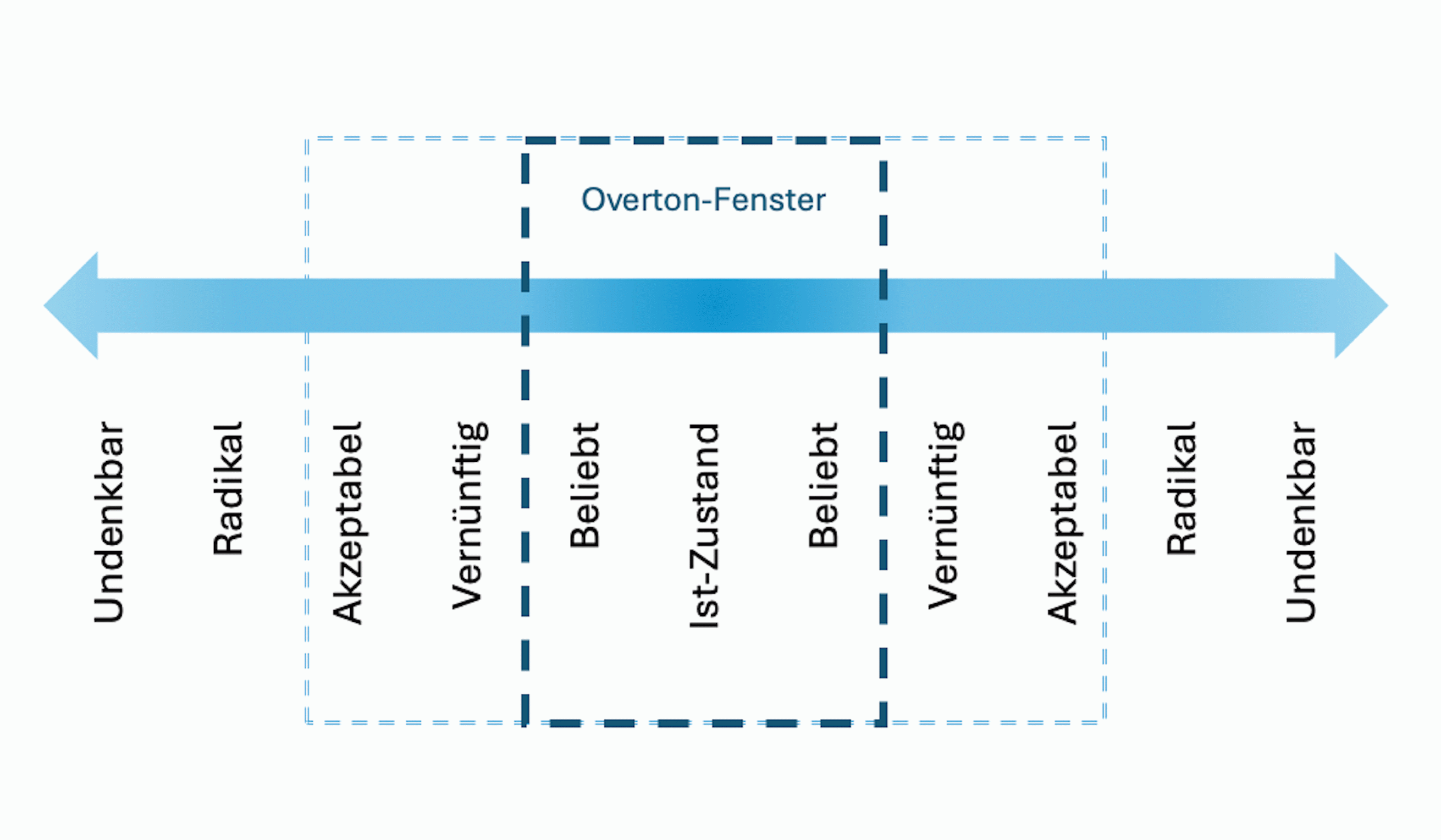
Will eine Partei etwas außerhalb des Fensters erreichen, so das Konzept, muss sie zunächst das Fenster verschieben. Und das gelingt am besten, indem sie etwas fordert, was noch viel weiter außerhalb des Fensters liegt.
Ich will etwas erreichen, was aktuell als radikal gilt? Dann sage ich etwas, was als unsagbar gilt. Ich provoziere einen großen Aufschrei, alle Welt diskutiert über meine Aussage, ich entschuldige mich halbherzig, lenke ein wenig ein und stelle eine etwas weniger krasse Forderung: Schwupps, erscheint das, was noch zwei Wochen zuvor als radikal galt, im Vergleich zu meiner ersten Aussage als moderat und diskussionswürdig.
Keine Ausrutscher, sondern ein bewusstes Verschieben des Fensters
Linke und grüne Parteien sind oft zögerlich, wenn es darum geht, krasse Forderungen zu stellen. Sie fürchten, mit zu radikalen Forderungen etwa nach Auto- oder Fleischverzicht oder einem bedingungslosen Grundeinkommen potenzielle Wähler*innen zu verschrecken. Trotzdem gibt es Themen, bei denen sich das Overton-Window in den letzten Jahrzehnten nach links verschoben hat (auch wenn sich der Trend derzeit wieder zu wenden scheint): Frauen- und LGBT-Rechte, Antidiskriminierung oder Klimaschutz sind dafür Beispiele.
Die radikale Rechte hingegen kennt das Konzept des Overton-Windows nicht nur als beschreibende Kategorie, sondern setzt es gezielt als Strategie ein. All die krassen „Einzelfälle“, die Grenzüberschreitungen rechter Politiker*innen: das sind keine Ausrutscher, keine Momente des Kontrollverlusts. Es sind bewusst gesetzte Provokationen, deren Ziel es ist, das Overton-Window zu verschieben.
Bei allem, was mit Migration, Asyl und Integration zu tun hat, aber auch in Fragen der Rechtsstaatlichkeit ist es der Rechten in den letzten Jahren auf diese Weise gelungen, das Fenster immer weiter nach rechts zu verschieben.
Die konservativen Parteien als nützliche Idioten
Was das alles mit Friedrich Merz zu tun hat?
Eine Aussage, über die niemand diskutiert, verschiebt noch nicht das Overton-Fenster. Erst durch die öffentliche Debatte verschiebt es sich.
Ganz alleine können radikal rechte Parteien das Fenster also nicht bewegen. Sie brauchen dafür Hilfe – die Art von Hilfe, die Merz gerade leistet. Erst, indem Politiker*innen der Mitte-Parteien jene Dinge sagen, fordern und tun, die zuvor nur von Ultrarechten kamen, verschiebt sich das Fenster. Erst dann wird das, was zuvor als radikal galt, plötzlich als akzeptabel angesehen.
Was ist Erfolg: Wahlen gewinnen oder Ziele erreichen?
Um das Problem mit der Annäherungs-Strategie zu verstehen, muss man sich auch die Frage stellen: Wie definiere ich politischen Erfolg? Besteht politischer Erfolg darin, die nächsten Wahlen zu gewinnen und mitzuregieren? Oder besteht er darin, dass die eigenen Ziele umgesetzt werden?
Die Annäherungs-Strategie denkt politischen Erfolg rein auf der wahltaktischen Ebene: Die Wählenden wollen das, was die AfD fordert; wenn wir ihnen weit genug entgegenkommen, werden sie statt der AfD doch lieber uns wählen. Dass man dann, selbst wenn das Kalkül bei den Wahlen aufgeht, nicht die originär eigenen Ziele umsetzt, sondern die der politischen Konkurrenz, wird dabei übersehen oder in Kauf genommen.
Aber selbst rein wahltaktisch funktioniert die Strategie nicht besonders gut. In Österreich ist sie in all den Jahren auf Bundesebene nur ein einziges Mal aufgegangen, nämlich 2017 für Sebastian Kurz.
Von dieser Ausnahme abgesehen konnte die ÖVP immer nur dann Wähler*innen von der FPÖ zurückgewinnen, wenn sich diese soeben mal wieder mit Skandalen aus der Regierung katapultiert hatte.
Die These, Parteien wie die FPÖ oder die AfD würden sich schon selbst „entzaubern“, sobald sie an der Macht seien, ist also nicht völlig falsch. Aber sie hat zwei große Haken: Erstens hat die Entzauberung in Österreich nie lange angehalten. Und zweitens kann eine rechtsradikale Partei auch in einer kurzen Regierungszeit sehr viel zertrümmern. Die Korruptionsprozesse aus der schwarz-blauen Koalition Anfang der 2000er Jahre beschäftigen die Gerichte bis heute – und dann sind da noch die dauerhaften Folgen für den gesellschaftlichen Diskurs.
Original statt Kopie
Mit Ausnahme von Sebastian Kurz’ Wahlerfolg 2017 hat die Annäherungs-Strategie über die Jahre hinweg in Österreich genau zwei Dinge bewirkt, und die sollten Deutschland nachdenklich machen.
Erstens: Die Strategie lässt FPÖ und AfD als diejenigen dastehen, die als Erste jene „unangenehmen Wahrheiten“ ausgesprochen haben, die die anderen Parteien später ebenfalls anerkennen mussten. Wenn ich als Wählerin zwischen zwei Parteien schwanke, und ich sehe immer wieder, wie die eine die Forderungen der anderen erst als falsch deklariert, sich ihnen dann aber doch annähert, sie übernimmt und umsetzt: Dann entsteht der Eindruck, dass die radikalere Partei von vornherein recht hatte und offenbar Probleme schneller erkennt als die gemäßigtere. Warum sollte ich bei der nächsten Forderung der radikalen Partei nicht davon ausgehen, dass es auch diesmal so ist? In Österreich gibt es dafür eine Redewendung: Die Wähler*innen gehen „zum Schmied und nicht zum Schmiedl“, zum Original und nicht zur Kopie.
Der Diskurs ist nach rechts gerutscht
Zweitens: Der politische Diskurs insbesondere bei den Themen Asyl, Migration und Integration rutscht durch die Annäherungs-Strategie weiter und weiter und weiter nach rechts. Die ÖVP steht heute bei diesen Themen ungefähr da, wo früher die FPÖ stand; die FPÖ steht weiter rechts als je zuvor. Denn auch die Forderungen der ultrarechten Parteien sind nicht starr und unveränderlich. Wenn die Mitte-Parteien die Forderungen von FPÖ und AfD übernehmen – dann stellen diese neue, noch radikalere Forderungen auf. Sie müssen das sogar tun, denn sie leben von der Provokation. Wenn eine Forderung nicht mehr provoziert, muss eine krassere her. Wenn konservative Parteien also Forderungen der Rechtsradikalen übernehmen, öffnen sie ihnen den Weg, noch weiter nach rechts zu rücken.
Vor der Wahl und nach der Wahl
Nach Jahrzehnten der Annäherungs-Strategie steht also in Österreich die FPÖ so weit rechts wie nie zuvor – und ist im Herbst mit 29 Prozent der Stimmen erstmals stärkste Partei geworden.
Und in Deutschland?
Friedrich Merz hat zuletzt mehrfach und eindeutig eine Koalition mit der AfD ausgeschlossen, und praktisch alle politischen Beobachter*innen halten das für glaubwürdig.
Allerdings hat auch ÖVP-Chef Karl Nehammer vor der Wahl im Herbst mehrfach und eindeutig eine Koalition mit der Kickl-FPÖ ausgeschlossen, und praktisch alle politischen Beobachter*innen hielten das für glaubwürdig. Kickl sei eine „Gefahr für die Demokratie“, erklärten Nehammer und sein Generalsekretär Christian Stocker; „Wer Kickl verhindern will, muss Nehammer wählen“, postete die ÖVP zwei Tage vor der Wahl.
Viereinhalb Monate später ist Nehammer nicht mehr in der Politik – und Stocker hat einen Monat lang mit der FPÖ über die Details eines Regierungsabkommens verhandelt, das Kickl zum Kanzler machen sollte.
Update: Am Nachmittag des 12.2. hat die FPÖ ihre Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP für gescheitert erklärt. Zwei Stellen des Textes wurden um 15:40 entsprechend aktualisiert. Gescheitert sind die Verhandlungen offenbar in erster Linie daran, dass die FPÖ darauf bestand, neben dem Kanzleramt auch sowohl das Finanz- als auch das Innenministerium zu bekommen, und an FPÖ-Forderungen wie jener, dass Österreich Entscheidungen internationaler Gerichte nicht mehr umsetzen solle.