- RiffReporter /
- Umwelt /
Bis 2030 soll die schlimmste Zerstörung enden, bis 2050 „Harmonie mit der Natur“ herrschen
2384 Tage bis zur Stunde der Wahrheit: Kann das Weltnaturabkommen die Verarmung der Erde aufhalten?
Bei der COP15 der Vereinten Nationen in Montreal haben sich 196 Staaten auf vier Großziele bis 2050 und 23 konkrete Ziele bis 2030 geeinigt. 2026 soll eine erste Zwischenbilanz gezogen werden. Was genau soll passieren, um die Biodiversität zu erhalten?

Papier ist geduldig, sagt man. Doch für das Weltnaturabkommen, das 196 Staaten am 19. Dezember in Montreal beschlossen haben, gilt das nicht. Es strotzt nur so vor Ungeduld. Fast alle Staaten der Erde setzen sich 23 konkrete Ziele bis zum Jahr 2030 – und verpflichten sich, bis 2050 die Vision wahr werden zu lassen, dass die Menschheit „in Harmonie mit der Natur“ lebt.
Gut 6000 Wörter sind es am Ende geworden, nachdem Tausende Delegierte aus aller Welt über Wochen in einem weitgehend fensterlosen Konferenzzentrum getagt hatten, weit entfernt von den Korallenriffen, Flüssen, Tropenwäldern und artenreichen Feuchtgebieten, um die es ging.
Kann da etwas Gutes herauskommen? Oder ist das alles „BlaBlaBla“ und Greenwashing, wie Greta Thunberg solche Bemühungen charakterisiert hat?
Nachdem dieselben Staaten zwischen 2010 und 2020 ähnliche Ziele beinahe komplett verfehlt haben, könnte man den „Kunming-Montreal Globalen Biodiversitäts-Rahmen“, wie das Dokument offiziell heißt, entweder als blumigen, hehren Idealismus und Wunschdenken oder aber als politisches Ablenkungsmanöver abtun.

Doch dazu liefen die Verhandlungen zu ernst, wurde zu verbissen um jedes Wort gekämpft. Und wer das Abkommen bis zu Ende liest, der weiß, dass es tief ins Herz des heutigen Wirtschaftssystems zielt und von Regierungen Änderungen in Dimensionen verlangt, die bis heute nirgendwo konkret so ernsthaft zur Debatte stehen. Routinen, Regeln, Lebensstile müssten sich schnell und messbar verändern. Und das soll jetzt geschehen. Es geht um den Alltag jedes Menschen – und um Billionenbeträge aus Staatsbudgets und Privatwirtschaft.
Ohne funktionierende Ökosysteme sind Welternährung und Wasserversorgung in Gefahr
Das Weltnaturabkommen jetzt nicht sehr ernst zu nehmen, würde im Desaster enden: Denn es ist das Beste, woran Regierungen gemessen werden können. Sie haben selbst zugestimmt. Wenn die meisten Staaten das Abkommen schnell wieder vergessen und so weitermachen können wie bisher, dann werden die Lebenskräfte der Erde weiter schwinden. Und das geht zulasten vor allem der jungen und künftigen Menschen. Selbst der meist nüchterne Olaf Scholz fand drastische Worte, als er sich im Vorfeld der COP15 zur Biodiversität äußerte: Der Herzschlag der Erde werde „mit jeder Art, die für immer ausstirbt, schwächer“.

Arten sterben aus, oft bevor Wissenschaftler sie entdeckt und wissenschaftlich beschrieben haben. Lebensräume, die uns Menschen Nahrung und Wasser spenden, verarmen und veröden. Das Risiko großer Hungersnöte steigt, wenn Böden ihre von zahllosen Kleinstlebewesen abhängige Fruchtbarkeit verlieren. Weitere Pandemien werden wahrscheinlicher, wenn Menschen immer tiefer in bisherige Wildnisgebiete vorstoßen und die dortigen Viren und Bakterien über Straßen, Siedlungen und Flugzeuge den Weg um den Globus antreten können.
Das Abkommen beschwört aus gutem Grund Generationengerechtigkeit: Heute kann zerstörte Natur – etwa in Form von Tierfutter aus abgeholzten Regenwaldgebieten, billigem Holz oder Baugebieten auf früheren Feuchtgebieten – noch in den klassischen materiellen Wohlstand verwandelt werden, wie ihn die Industriestaaten nach dem Zweiten Weltkrieg definiert und seither verfolgt und in aller Welt als Ideal verbreitet haben. Die Überreste dieser Materialschlacht stapeln sich zur neuen geologischen Epoche, dem Anthropozän, und heizen die Erde auf.
Mitten im juristischen Jargon steht: „Mutter Erde“
Morgen dagegen könnten die Löcher im Netz des Lebens zu groß geworden sein. Was der Naturhaushalt für uns Menschen leistet, galt bisher als selbstverständlich. Lebendige Wälder, sprudelnde Quellen, regenerierende Naturlandschaften, kohlenstoffspeichernde Moore tauchen deshalb in keinem Staatsbudget und kaum einer Firmenbilanz auf der Haben-Seite auf. Naturzerstörung wird nicht als Soll erfasst, sie hat keinen unmittelbaren Preis.

Für die jungen und künftigen Menschen wird dies bei einem „business as usual“ heißen, dass ihnen die Biosphäre den Dienst versagt, mit vielen ungewollten, noch unbekannten und vor allem harten Konsequenzen.
„Alarmiert“ seien die Staaten über diese Entwicklung – das ist nach einigen Höflichkeitsformeln am Beginn des Abkommens und nach Erinnerungen daran, mit wievielen Mühen es zustande gekommen ist, der erste klare Hinweis darauf, wie ungemein dringlich eine Kursänderung ist. Dann wird ausbuchstabiert, was die Natur leistet: „Essen, Medizin, Energie, saubere Luft und sauberes Wasser, Schutz vor Naturkatastrophen, Erholung und kulturelle Inspiration.“ Es gehe um „alle Systeme des Lebens“.

Während „Systeme“ sehr abstrakt klingt, bietet das Abkommen auch andere Beschreibungen der Lebensprozesse auf der Erde an – besonders fällt die mehrfache Nennung des Begriffs „Mutter Erde“ auf. Das ist für einen klassischen Rechtstext eher ungewöhnlich. Es spiegelt jüngere Neuerungen in Verfassungen vor allem in südamerikanischen Ländern wie Bolivien wider, der Natur Personenrechte zuzuschreiben.
Um die Dramatik der Lage zu veranschaulichen, referiert das Abkommen die Warnungen der Wissenschaft, wie sie vor allem der Weltbiodiversitätsrat IPBES – das ökologische Gegenstück zum Weltklimarat IPCC – unmissverständlich formuliert hat.
Ein naturwissenschaftliches Fundament
Eine Million von geschätzt acht Millionen Arten sind demnach vom Aussterben bedroht. Wer sagt, dass doch schon immer Arten ausgestorben seien, dem entgegnet das Abkommen mit dem IPBES-Befund, dass dies derzeit „zehn bis hundert Mal schneller geschieht als im Durchschnitt der letzten 10 Millionen Jahre“. Der Schwund der Biodiversität verlaufe „rascher als je zuvor in der Geschichte der Menschheit“, und es drohe eine „weitere Beschleunigung“.
Damit wird klargestellt: Das Biodiversitätsabkommen steht auf einem naturwissenschaftlichen Fundament. Weil dadurch Handlungsdruck entsteht, standen im dreiwöchigen Ringen um den Vertragstext die Verweise auf den Weltbiodiversitätsrat auf der Kippe. Einige Staaten wollten sie partout nicht erwähnt haben. Allein das zeigt, wie wenig selbstverständlich es ist, dass am Ende ein Abkommen zustande kam.

Doch die Wissenschaft hat nicht nur Alarm zu bieten. Es sei möglich, Natur zu „erhalten, restaurieren und nachhaltig zu nutzen“, heißt es. Das ist mehr als nur ein Hoffnungsschimmer, wenn 196 Staaten es sich per Beschluss zu eigen machen.
Dies gilt auch für die fünf wichtigsten Ursachen des Biodiversitätsverlusts, die ihrer Bedeutung für die Naturzerstörung nach aufgereiht sind:
- Änderungen, wie Menschen Land und Meere nutzen – damit ist vor allem die industrielle Landwirtschaft und Fischerei gemeint
- Direkte Ausbeutung von Lebewesen auf einem zu hohen Niveau – wie etwa die industrielle Fischerei, die exzessive Jagd und Wilderei von Tieren oder der Handel mit Wildtieren
- Klimawandel – weil schnelle Erwärmung Arten und natürliche Lebensgemeinschaften überfordern kann
- Umweltverschmutzung – etwa durch Luftschadstoffe, Pestizide, Stickstoff aus Düngung oder Plastik
- das Vordringen gebietsfremder „invasiver“ Arten – weil sie die jeweils spezialisierten heimischen Lebensgemeinschaften stören und nur lokal vorkommende Arten etwa auf isolierten Inseln verdrängen können
Im Abkommen werden aber auch tiefere Ursachen angesprochen, nämlich das grundlegende Verhältnis zur Natur: Letztlich lägen allen Problemen „soziale Werte“ und „Verhaltensweisen“ zugrunde.
Von der Beschreibung der Dringlichkeit geht das Abkommen dann zum Thema Taten über: Ein „ambitionierter Plan“ sei nötig und „breit angelegtes Handeln“, um eine „Transformation im Verhältnis unserer Gesellschaften zur Biodiversität“ zu erreichen und bis 2050 zur beschworenen „Harmonie mit der Natur“ zu gelangen. Dieses ungewohnt blumig formulierte Fernziel war schon 2010 von einer früheren Biodiversitätskonferenz ausgegeben worden und wird nun im Abkommen so definiert:
„Bis 2050 wird die biologische Vielfalt wertgeschätzt, erhalten, wiederhergestellt und sinnvoll genutzt, sodass die Ökosystemleistungen erhalten bleiben, ein gesunder Planet bewahrt wird und alle Menschen davon profitieren können.“
Der Text von Montreal erhebt dabei einen bemerkenswert umfassenden Anspruch für seine Gültigkeit: Es wurde von Nationalstaaten beschlossen, soll aber nicht nur das Handeln von deren Regierungen leiten – sondern die gesamte Entwicklung der Menschheit, von kleinen „lokalen Gemeinschaften“ und „lokalen Regierungen“, womit indigene Selbstverwaltungsstrukturen ebenso wie Stadt- und Gemeinderäte gemeint sind, aufwärts.

Es heißt:
„Dies ist ein Rahmen für alle – für die gesamte Regierung und die gesamte Gesellschaft. Sein Erfolg erfordert politischen Willen und Anerkennung auf höchster Regierungsebene und beruht auf Maßnahmen und Zusammenarbeit auf allen Regierungsebenen und von allen Akteuren der Gesellschaft.“
Und alle gemeinsam sollen wiederum ihre Politik, ihre Ziele, Strategien und Aktionspläne „überarbeiten, weiterentwickeln und aktualisieren“. Es soll also wirklich keiner sagen können, dass ihn dieser Staatenbeschluss zur Biodiversität nichts angeht.
Eine historische Anerkennung indigener Rechte und Leistungen
Diesem umfassenden Anspruch steht indes seine mangelnde rechtliche Verbindlichkeit gegenüber. Das Rahmenabkommen ist kein völkerrechtlich verbindlicher Vertrag. Es gibt keinen Gerichtshof, vor dem jemand einen Staat oder gar die ganze Staatengemeinschaft dafür zur Rechenschaft ziehen kann, gegen die Ziele zu verstoßen oder sie nicht zu erreichen.
Seine Kraft muss das Abkommen aus dem politischen Willen seiner Mitglieder schöpfen, es verwirklichen zu wollen. Das kann man als Schwäche sehen. Anders ist es in einem Prozess aber nicht möglich, der auf Einigkeit und fast allen Staaten der Erde setzt. Die USA und der Vatikan sind die einzigen Staaten auf der Erde, die nicht Teil der UN-Biodiversitätskonvention sind, unter deren Dach das Abkommen steht.

Wie allumfassend das Abkommen gelten und wirken soll, wird auch dadurch klar, welche Teile der Menschheit besonders gewürdigt werden. Großen Raum nehmen dabei Indigene ein, also Menschen in jenen traditionellen, oft seit Jahrtausenden bestehenden Gemeinschaften, die seit dem 16. Jahrhundert in Invasionswellen von den europäischen Nationalstaaten erobert und gewaltsam ausgebeutet wurden. Viele Millionen Indigene wurden dabei systematisch ermordet. Ihre Gemeinschaften haben sich aber oft als resilient erwiesen. Heute gilt jeder zwanzigste Mensch als indigen – und auf den verbliebenen Territorien ballt sich die Biodiversität der Erde massiv.
Doch echte Entscheidungsbefugnis über ihr Land und Mitsprache bei den Versammlungen der seit 1945 vereinten Nationalstaaten gab es bisher nicht. Das Kunming-Montreal-Abkommen erkennt nun in deutlichen Worten „die wichtige Rolle und den Beitrag indigener Völker und lokaler Gemeinschaften als Hüter der biologischen Vielfalt und Partner bei der Erhaltung, Wiederherstellung und nachhaltigen Nutzung“ an.
Kein Naturschutz gegen Indigene
Während Indigene bisher oft damit konfrontiert waren, dass Kolonialisten und ihre Nachfolger auch zum Zweck oder Anschein von Naturschutz zum Beispiel Teile ihrer Territorien einzäunten oder sogar indigene Bewohner vertrieben, sollen solche Praktiken endgültig der Geschichte angehören – zumindest dürfte das Abkommen ihnen Rückendeckung im Kampf gegen einen solchen „Festungsnaturschutz“ geben, der oft nur Vorwand ist, auf den betroffenen Gebieten die Natur durch Bergbau, Holzeinschlag oder Tourismus ausbeuten zu können.

Bei der Umsetzung des Abkommens müsse für die Indigenen
„…sichergestellt werden, dass ihre Rechte, ihr Wissen, einschließlich ihres traditionellen Wissens über die biologische Vielfalt, ihre Innovationen, ihre Weltanschauungen, ihre Werte und ihre Praktiken im Einklang mit den einschlägigen nationalen Rechtsvorschriften, den internationalen Instrumenten, einschließlich der Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte der indigenen Völker, und den Menschenrechtsvorschriften geachtet, dokumentiert und mit ihrer freien, vorherigen und in Kenntnis der Sachlage erteilten Zustimmung bewahrt werden, auch durch ihre uneingeschränkte und wirksame Beteiligung an der Entscheidungsfindung.“
Nichts am Rahmenabkommen dürfe „so ausgelegt werden, dass die Rechte, die indigene Völker derzeit haben oder in Zukunft erwerben können, geschmälert oder annulliert werden“.

Über wenige andere Passagen wurde so heftig gerungen, wie um die Absicherung der Landrechte für indigene Gemeinschaften und lokale Bevölkerungen. Nun werden die Rechte der Indigenen nicht nur formelhaft beschworen, sondern konkret bei den Zielen bis 2030 genannt.
Eine so weitreichende Anerkennung, Rückdeckung und Absicherung haben Indigene bisher nie erfahren – weshalb ihre Vertreter den Beschluss von Montreal positiv bewertet haben. Bis dahin war es auch in den Verhandlungen in Montreal kein leichter Weg.
Besonders betont werden zudem die Allgemeinen Menschenrechte und die Gleichberechtigung der Geschlechter. Es heißt sogar, dass das Abkommen ohne ein „empowerment“, also eine Stärkung, von Frauen und Mädchen nicht erreicht werden können. Beschworen werden dafür auch der Wert der Wissenschaft, der Generationengerechtigkeit und von Bildung.
Ziel ist es, ein sechstes Massenaussterben in der Erdgeschichte zu verhindern
Die ersten sieben Seiten des Abkommens sollen ein Fundament bilden, auf das dann die eigentlichen Ziele aufbauen – vier überwölbende Großziele („Goals“) bis 2050 beschreiben den Zielzustand und 23 konkrete Ziele („Targets“) sollen bis 2030 den Weg dorthin weisen.

Die vier Goals bis 2050 spiegeln wider, wozu der legendäre „Erdgipfel“ der Vereinten Nationen 1992 in Rio de Janeiro die Konvention über biologische Vielfalt überhaupt geschaffen hat und was bisher erkennbar nicht gelungen ist:
- Arten und Ökosysteme zu erhalten
- sie nachhaltig zu nutzen
- wirtschaftliche Zugewinne aus der Nutzung fair und gerecht zu teilen.
Das erste Groß-Ziel für 2050 heißt deshalb: Die Unversehrtheit, Vernetzung und Widerstandsfähigkeit aller Ökosysteme wird erhalten, verbessert oder wiederhergestellt. Die Ausdehnung natürlicher Ökosysteme soll dabei bis 2050 erheblich wachsen. Arten, von denen bekannt ist, dass sie derzeit unmittelbar vom Aussterben bedroht sind, sollen gerettet werden.

Bis 2050 soll die Aussterberate und -risiko aller Arten um das Zehnfache reduziert werden. Die Bestände aller wild lebenden Arten sollen so groß sein, dass sie als „gesund und widerstandsfähig“ gelten können. Die Erde schon der nahen Zukunft soll also nicht mehr von industriell ausgebeuteten Landschaften geprägt sein, sondern wieder lebensfreundlicher werden.
Den Wert der Natur sichtbar machen
Bisher warnen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler davor, dass wir am Beginn eines sechsten Massenaussterbens stehen könnten. Das fünfte solche Ereignis hat das Ende der Dinosaurier besiegelt. Erstmals in der Geschichte des Planeten setzt heute eine einzelne Primatenspezies ein solches Ereignis in Gang – und lässt eine Versammlung von einigen Tausend Vertreterinnen und Vertreten nun beschließen, das todbringende Geschehen in wenigen Jahrzehnten zu stoppen.
Dies soll auch die sogenannten „Funktionen und Dienstleistungen von Ökosystemen“ erhalten oder wiederherstellen. Was im zweiten Großziel abstrakt klingt, könnte konkreter nicht sein – deshalb wurden gleich am Beginn des Abkommens etwa Essen, Trinkwasser oder Medizin genannt. 2050 soll also im Gegensatz zu heute kein junger Mensch mehr fürchten müssen, dass die Erwachsenen den Ast absägen, auf dem die nächsten Generationen sitzen.

Ein gewaltiger Fortschritt gegenüber dem bisherigen Blick auf die Natur in internationalen Abkommen ist die Tatsache, dass im zweiten Leitziel – Goal B – das, was die Natur für den Menschen leistet, nicht mehr nur in Euro und Dollar betrachtet wird. Diese „Ökosystemleistungen“ werden verstanden als Teil von viel weitergehenden „Beiträgen der Natur für den Menschen“: Diese Betrachtungsweise schafft Raum, um spirituellen, emotionalen und intellektuellen Wirkungen der Natur auf Menschen einen Wert zuzumessen. Das zielt darauf ab, nicht alles nur in Geldwährung umzurechnen, wie das etwa mit den bis zu 577 Milliarden Dollar Gegenwert der Bestäubung von Nutzpflanzen durch Insekten gemacht wurde, auf die Agrarökonomen gekommen sind. Der Wert der Natur geht über monetär Messbares weit hinaus.
Front gegen Biopiraterie
Bei den zwei weiteren Großzielen für 2050 geht es dann erstmals in dem Dokument sehr klar und hart ums Geld – um das Geldverdienen mit Biodiversität einerseits und andererseits um das Geld, das nötig ist, die Biodiversität zu schützen.
Mit Biodiversität wird auf vielfältige Weise Geld verdient. Ökonomen schätzen, dass die Hälfte der globalen Wertschöpfung unmittelbar der Natur entstammt. Gemeint sind hier neben unverzichtbaren Naturfunktionen wie Bodenfruchtbarkeit meist speziellere Geschäfte – nämlich mit dem Wissen um den Wert etwa von bestimmten Pflanzen für die Medizin.
Früher war es üblich, dass Kolonialisten, Reisende und Wissenschaftler Pflanzen ins eigene Land mitbrachten, kultivierten und oftmals sehr reich damit wurden. Das klassische Beispiel ist, wie Ende des 19. Jahrhunderts ein britischer Reisender Samen der Kautschukpflanze in Brasilien kaufte und darauf ein eigenes weltumspannendes Geschäft mit Gummiprodukten aufbaute.
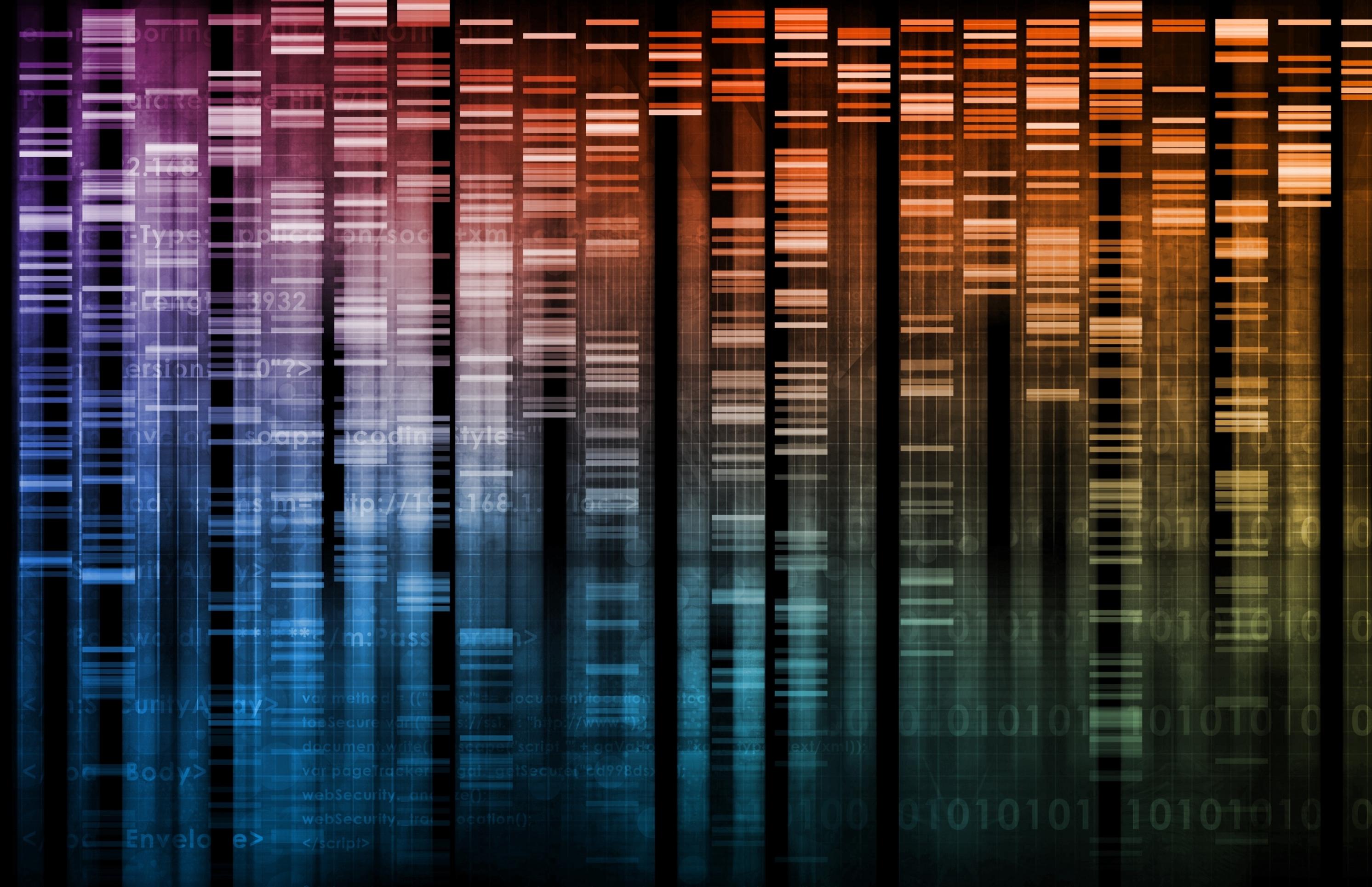
Im 20. Jahrhundert entsandten dann Pharmaunternehmen Sammler auf der Suche nach neuen Wirkstoffen. Sie zapften dabei häufig das Wissen indigener Gemeinschaften an, die über Jahrhunderte die Wirkung bestimmter Pflanzen erkundet hatten und weitergaben, was bei Versuch-und-Irrtum herausgekommen war. Wenn dann eine Firma im Westen ein neues Medizinprodukt auf der Basis dieses Wissens vermarktete, war es lange überhaupt nicht üblich, dass die indigenen Gemeinschaften irgendwie mitverdienen. Die „Biopiraten“, wie diese Sammler später gebrandmarkt wurden, waren längst über alle Berge.
Ärmere Länder sollen an ihrem Naturreichtum verdienen können
Schon die Biodiversitäts-Konvention von 1992 sollte dem einen Riegel vorschieben. Als Modell für die Zukunft galt das Nationale Biodiversitätsinstitut von Costa Rica (Inbio), das legales „bioprospecting“ organisieren und Anteile an den Profiten in den Naturschutz stecken sollte. Ein wirklicher Renner waren diese Ansätze bisher aber nicht. Und wenn es Einnahmen gab, dann landeten diese bei den Regierungen der Nationalstaaten, nicht bei den indigenen Wissensträgern. Das dritte Großziel des Kunming-Montreal-Abkommens – Goal C – lautet daher, Einkommen aus der wirtschaftlichen Nutzung etwa von Molekülen oder Gensequenzen bis 2050 deutlich zu steigern und diese „angemessen“ mit indigenen Gemeinschaften zu teilen.
Erstmals werden dabei auch sogenannte „digitale Sequenzinformationen“ (DSI) einbezogen. Dabei handelt es sich nicht um biologische Substanzen selbst, sondern digital gespeicherte Informationen zum Beispiel über ihren Aufbau. Bei Indigenen und Regierungen ärmerer Länder ging die Angst um, dass man künftig gar keine „Biopiraten“ mehr losschicken muss, sondern aus vorhandenen Proben Wissen extrahieren und vermarkten kann, ohne dass die Menschen in den Ursprungsländern daran teilhaben.
Auch wenn es sich um ein Spezialthema handelt, war der Umgang mit digitalen Sequenzinformationen bei den Verhandlungen auf der COP15 eines der wichtigsten und am härtesten umstrittenen Themen – eben weil sich damit das Versprechen sehr hoher Einnahmen und einer gerechteren Verteilung der Vorteile einer reichhaltigen Biodiversität verbindet. Das führte gelegentlich zu merkwürdigen Allianzen. Im Westen fürchteten Wissenschaftler nämlich, dass strenge Regeln ihre Forschung behindern könnten. Hier trafen sie sich mit der Position aus Ländern, in denen die Pharmaindustrie stark ist. Inhaltlich wird der Streit um DSI außerhalb des Rahmenabkommens behandelt. Das dritte Großziel schlägt aber in jedem Fall den Pflock ein, dass Ursprungsländer und Indigene an möglichen Profiten beteiligt werden müssen.

Vollends deutlich werden die Dimensionen der Beschlüsse von Montreal beim letzten strategischen Ziel für 2050 – dem Goal D. Ärmere Länder müssen demnach massiv von den reichen Ländern dafür bezahlt werden, im Dienst von Natur und Menschheit auf kurzfristige Profite nach westlichem Muster zu verzichten und ihre Biodiversität gemäß den folgenden 23 Aktionszielen zu erhalten.
Selbst im besten Fall bleiben die Militärausgaben dreimal höher
Das Abkommen beziffert eine Finanzlücke von 700 Milliarden Dollar pro Jahr. Soviel Geld müsste von der Staatengemeinschaft aufgebracht werden, um alle 23 Ziele umzusetzen und damit das Artensterben und die Zerstörung der Natur bis 2030 zu stoppen und auf einen Pfad der Erholung zu bringen.
700 Milliarden – das entspricht in heutigen Zahlen 17 Prozent des Bruttosozialprodukts von Deutschland oder immerhin vier Prozent der Wirtschaftsleistung von China. Allerdings relativiert sich diese Zahl, wenn man in Betracht zieht, dass sie nur ein Drittel der globalen Militärausgaben darstellt und weniger als das Vierfache der Summe, die Qatar ausgegeben hat, um die Fußball-Weltmeisterschaft auszurichten. Es ist in jedem Fall ein Vielfaches der bisher zum Schutz der Biosphäre investierten Summen.
Den Kern des Abkommens bilden die 23 Aktionsziele, die schon bis zum Jahr 2030 erreicht sein sollen. Sie haben in Medien auch die meiste Aufmerksamkeit bekommen.
Die 23 Ziele bis 2030
2030 – das ist nicht viel Zeit angesichts der weitreichenden Veränderungen, die in diesen Zielen beschrieben sind. Die Zeit drängt, weil so viele Verluste an Arten und Ökosystemen irreversibel sind oder es Unsummen kosten würde, sie wieder rückgängig zu machen.
Die 23 Ziele sind also der konkreteste Masterplan, den die Menschheit je hatte, damit die Biosphäre lebendig und lebensfreundlich bleibt:
Biodiversität in alle Planungsprozesse integrieren
Bisher haben Planer, Politiker und Manager ökologische Folgen oft ignoriert. Ziel 1 zufolge gibt es 2030 weder an Land noch im Meer noch Planungsprozesse, bei denen der Naturschutz außen vor gelassen wird. Das soll vor allem die noch existierenden Wildnisgebiete der Erde schützen und zudem sicherstellen, dass der weitere Verlust von Gebieten mit bedeutender Biodiversität „nahe Null“ liegt. Die Formulierung, dass die Zerstörung ausnahmslos aller noch intakten Ökosysteme bis 2030 gänzlich gestoppt wird, wurde in letzter Minute aus dem Dokument herausverhandelt. Doch auch das beschlossene Ziel würde bedeuten, dass etwa noch intakte boreale Wälder, Tropenwälder, Mangroven und Feuchtgebiete schon in sieben Jahren fast vollständig erhalten blieben und ihre Zerstörung bis dahin schrittweise reduziert wird.

Verödete Ökosysteme wiederherstellen
Große Teil der Erdoberfläche sind schon so stark beschädigt, dass sie als „degradiert“ gelten und sowohl ihres ökonomischen als auch ihres ökologischen Werts beraubt sind. Bis 2030 soll laut Ziel 2 auf 30 Prozent dieser Flächen damit begonnen worden sein, die ökologischen Wunden der Vergangenheit zu heilen. Von einer „effektiven Wiederherstellung“ ist die Rede, was bedeuten soll, dass etwa restaurierte Moore nicht nur oberflächlich so aussehen, sondern wieder anfangen, Torf zu bilden. Dasselbe Ziel hat sich die Europäische Union mit ihrer Biodiversitätsstrategie auf die Fahnen geschrieben.

Mindestens 30 Prozent der Erdoberfläche unter Schutz
Bis 2022 wurden nur 16 Prozent der Landfläche und 8 Prozent des Ozeans als Schutzgebiet ausgewiesen. Das dritte Ziel schreibt vor, das Netz der weltweiten Schutzgebiete deutlich engmaschiger zu machen. Es soll 30 Prozent der Fläche umfassen. Das wichtigste Wort ist allerdings „effektiv“. Zum Beispiel sind in Deutschland 45 Prozent der Meeresfläche auf dem Papier ein Schutzgebiet – ihr ökologischer Zustand ist aufgrund zahlreicher Ausnahmeregeln aber trotzdem schlecht. Das „30×30“-Ziel ist im Laufe der Verhandlungen abgeschwächt worden. Wissenschaftler und zahlreiche Regierungen wiesen in den Verhandlungen zudem darauf hin, dass 30 Prozent nur ein Anfang sein könnten, um das Artensterben zu beenden. Nach wissenschaftlichem Konsens ist eigentlich ein Schutz auf mindestens der Hälfte der Erdoberfläche nötig, um das ökologische Gleichgewicht wieder herzustellen.

Verstärkte Anstrengungen, um das Aussterben von Arten zu verhindern
Erst bis 2050 soll das Aussterben von Arten auf den Roten Listen der Weltnaturschutzunion wirklich gestoppt sein. Doch die Bemühungen sollen mit hoher Dringlichkeit verstärkt werden, besagt Ziel 4. Dasselbe gilt für die genetische Vielfalt innerhalb von wilden und kultivierten Arten – von ihr erhofft man sich zum Beispiel, Weizensorten zu finden, die mit Hitze und Trockenheit besser klarkommen als die heute angebauten Sorten.

Stärkere Kontrolle des Handels mit wildlebenden Tieren und Pflanzen
Weltweit wird mit Tieren oder Körperteilen von Tieren sowie Wildpflanzen gehandelt, etwa für Medizinprodukte. Dazu gehören auch Körperteile etwa von Nashörnern, denen eine durch nichts belegte potenzsteigernde Wirkung nachgesagt wird. Ein großer Faktor ist aber auch der riesige und weiter boomende Markt für exotische Haustiere. Ziel 5 besagt, dass bis 2030 illegaler Handel gestoppt und legaler Handel nur dann möglich sein soll, wenn er die betreffenden Arten und ihre Lebensräume nicht gefährdet. Gelänge dies, wäre das auch ein wichtiger Beitrag, um neuen Pandemien vorzubeugen, die durch zu engen Kontakt zu Wildtieren entstehen können.

Einschleppung von Arten halbieren
Mit Schiffen, Flugzeugen und Fahrzeugen transportieren Menschen unzählige Tier- und Pflanzenarten rund um den Globus. Manchmal geschieht das absichtlich, etwa bei Katzen als Haustieren, die dann auf isolierten Inseln Vogelarten an den Rand des Aussterbens bringen, manchmal unabsichtlich, etwa wenn Schiffe in ihrem Ballastwasser gebietsfremde Muscheln oder Algen mitbringen. Die mittlerweile auch in Deutschland heimische Asiatische Hornisse beispielsweise startete ihren Siegeszug in Europa von einem südfranzösischen Gartencenter aus, das Blumentöpfe aus Ostchina importiert hatte – einschließlich der blinden Passagiere. Das Tempo, mit dem sich „invasive gebietsfremde Arten“ ausbreiten, soll laut Ziel 6 bis 2030 halbiert werden. Das macht unter anderem viel strengere Aus- und Einfuhrkontrollen als bisher nötig.

Schäden durch Verschmutzung, Stickstoff, Pestizide und Plastik verringern
Bis 2030 soll die Umweltverschmutzung auf ein Level reduziert werden, bei dem Biodiversität und Ökosysteme keinen Schaden mehr nehmen. Das ist ein extrem anspruchsvolles Ziel, weil zum Beispiel zu viel Stickstoff, wie er in der industriellen Landwirtschaft in riesigen Mengen anfällt, artenreiche Blumenwiesen auslöscht und weil Pestizide nachweislich die Artenvielfalt in Bächen und anderen Kleingewässern reduzieren. Halbiert werden solle der Stickstoff-Überschuss und das Risiko aus dem Einsatz von Pestiziden bis 2030, schreibt Ziel 7 vor. Auf ein Ende der Plastikverschmutzung soll hingearbeitet werden. Ursprünglich wollten sich die Staaten auf ein komplettes Ende der Plastikverschmutzung bis 2030 einigen. Das zu erreichen, wird Aufgabe eines eigenen weltweiten Verhandlungsprozesses sein, der im Frühjahr von den Vereinten Nationen auf den Weg gebracht wurde.

Klimagefahren für die Natur reduzieren, auch mit Lösungen aus der Natur
Anstrengungen zum Klimaschutz sollen verhindern, dass die Erderwärmung Ökosystemen schadet und den Ozean durch zu viel zusätzliches Kohlendioxid versauern lässt. Für den Klimaschutz sollen gemäß Ziel 8 auch sogenannte „natur-basierte Lösungen“ zum Einsatz kommen. Darunter versteht man es, Lebensräume wie alte Laubwälder, Moore, Mangrovenwälder oder Seegraswiesen zu schützen und wiederherzustellen, die große Mengen Kohlenstoff speichern und der Atmosphäre CO₂ entziehen können. Mit diesem Ziel und einem korrespondierenden Beschluss auf dem Klimagipfel COP27 in Ägypten im November werden Klima- und Naturschutz endgültig miteinander verschränkt. „Wenn der Schutz der Biodiversität nicht Teil der Lösung ist, werden wir auch im Klimaschutz nicht vorankommen“, warnte Elizabeth Maruma Mrema, die Chefin der UN-Biodiversitätskonvention, im Gespräch mit RiffReporter.

Eine „nachhaltige“ Wirtschaftsweise umsetzen
Landwirtschaft und der Fischerei sollen nachhaltig werden, heißt es in den Zielen 9 bis 11 – das ist aber eigentlich schon seit 1992 vorgesehen. Die Diagnose der Konferenz ist, dass dies noch lange nicht gelungen ist. Nachhaltig bedeutet dabei nicht nur umweltfreundlich, sondern zugleich sozial gerecht und wirtschaftlich tragfähig, aber nicht nur kurzfristig, sondern auf Dauer. Für die Landwirtschaft ist besonders interessant, dass eine „nachhaltige Intensivierung“ explizit genannt wird. Während nämlich der klassische Biolandbau auf einer extensiven Nutzung von Flächen beruht, bedeutet „nachhaltige Intensivierung“, mehr aus weniger oder gleichen Flächen herauszuholen. Methoden, die dafür diskutiert werden, sind digital oder biotechnisch optimierte Praktiken. Diese werden aber nicht konkret genannt. Der Versuch, einen höheren Anteil für Biolandwirtschaft festzuschreiben, scheiterte in Montreal.
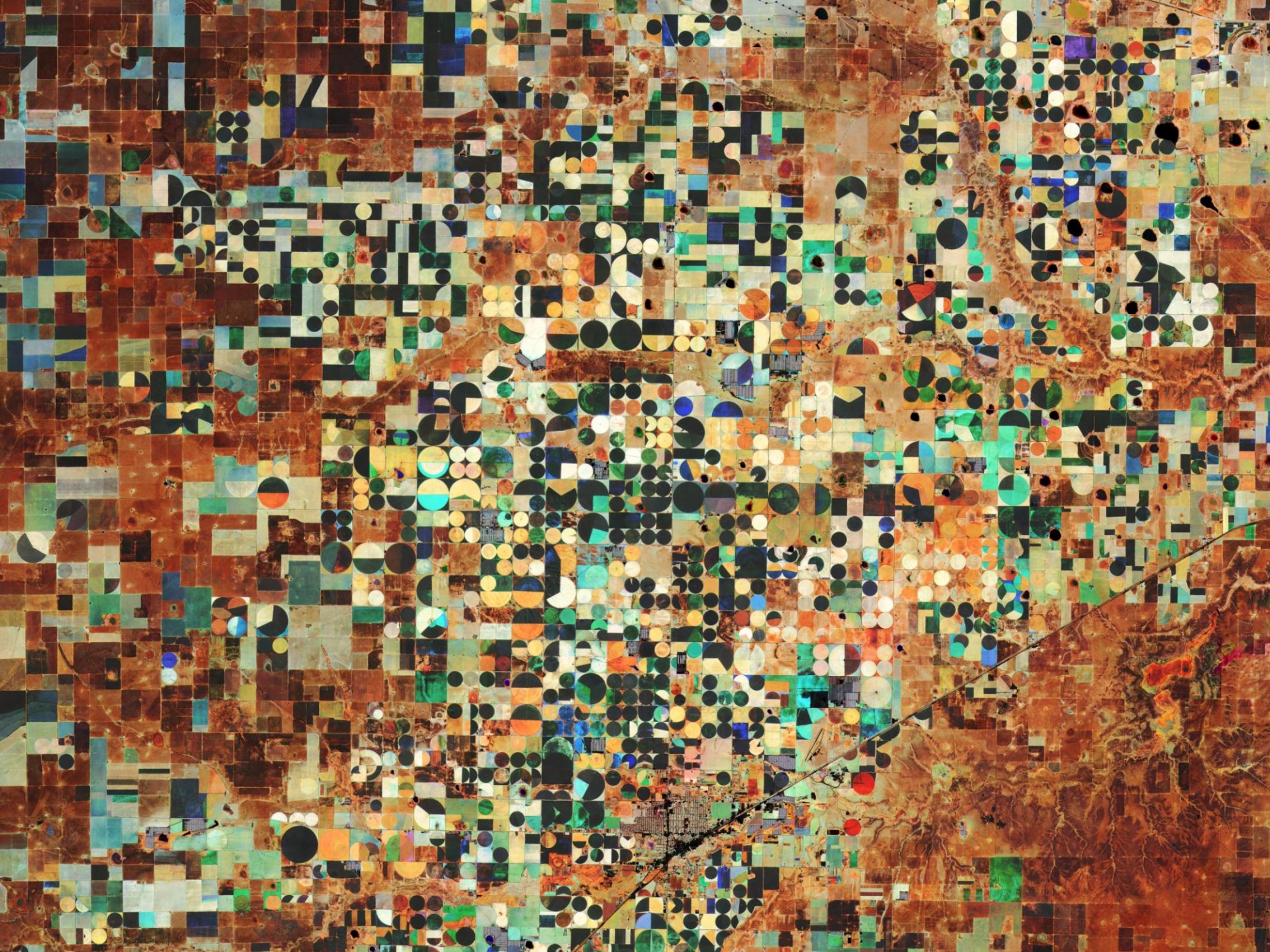
Grün- und Wasserflächen in Städten „signifikant erweitern“
Die Menschen in Städten und Ballungsräumen sollen in ihrer Nähe Natur und urbane Biodiversität erleben und sich dort erholen können. Besonders betont das Abkommen die „Konnektivität“ dieser Flächen. In Städten soll es also statt kleiner grüner Oasen künftig miteinander verbundene Netzwerke von Grün- und Wasserflächen geben. Ziel 12 formuliert also eine große Aufgabe für Stadtplanerinnen und Stadtplaner.

Die Wirtschaft auf den Schutz der Biodiversität trimmen
Ein lebendiger Regenwald oder ein Moor, das in Deutschland Kohlenstoff speichert, hat noch in keiner Bilanz einen Wert. Der entsteht erst, wenn Bäume gefällt und ihr Holz verkauft oder wenn ein Moor zu Gartenerde verarbeitet wird. Das Abkommen beschreibt ab Ziel 13 einen Weg, das Wirtschaftssystem grundlegend zu ändern. Bis 2030 sollen besonders transnationale Unternehmen und Geldhäuser die Auswirkungen ihrer Geschäfte auf die Natur überprüfen und ihren Kunden und Geschäftspartnern transparent kommunizieren. Der Versuch, dies verpflichtend vorzuschreiben, scheiterte indes trotz der Unterstützung durch zahlreiche Multis. Ab 2030 soll der ökologische Fußabdruck durch den Konsum wieder schrumpfen. Die Verschwendung von Lebensmitteln soll bis dahin halbiert werden.

Ausgaben für Naturschutz und Biodiversität massiv steigern
Auf 1800 Milliarden Dollar pro Jahr belaufen sich Analysen von Ökonomen zufolge die staatlichen Subventionen, die pro Jahr für Aktivitäten ausgezahlt werden, die dem Natur- und Klimaschutz direkt zuwiderlaufen. Während Staaten also bekunden, die Umwelt bewahren zu wollen, bezahlen sie aktiv für deren Zerstörung. Die Referenzsumme 1800 Milliarden taucht im Abkommen nicht auf. Gestützt auf Analysen der OECD wird aber das Ziel formuliert, dass die umweltschädlichen Subventionen ab sofort schrittweise schrumpfen und bis 2030 um 500 Milliarden Dollar niedriger liegen sollen als heute.
Zudem sollen von den fehlenden 700 Milliarden Dollar, die für effektiven Naturschutz nötig wären, bis 2030 mindestens 200 Milliarden mobilisiert sein. Diese Summe gilt für alle Länder der Erde – sie soll also von Industrie- und Entwicklungsländern bereitgestellt werden – und soll aus verschiedenen Quellen stammen: aus öffentlichen Haushalten, von Sponsoren, aus der Finanzwirtschaft und von Unternehmen.
Um den artenreichen, aber armen Entwicklungsländern den Schutz ihrer Biodiversität zu ermöglichen, sollen als Teil der Gesamtfinanzierung bis 2025 mindestens 20 Milliarden Dollar pro Jahr zur Verfügung gestellt werden und bis 2030 dann mindestens 30 Milliarden Dollar. Diese Summe liegt weit unter den von den Entwicklungsländern geforderten 100 Milliarden pro Jahr, entspricht aber einer Verdoppelung bisheriger Zusagen.
Ein Teil des Geldes für den Naturschutz soll aus privaten Quellen kommen und durch neuartige Geschäfte mit Biodiversität. Ziel 19 nennt zum Beispiel die Möglichkeit, für Ökosystemdienstleistungen zu zahlen, „grüne Anleihen“ auszugeben oder für Naturschäden Kompensationen zu zahlen. Hier besteht bei vielen Naturschützern die Sorge, dass mit dieser Öffnung wie beim Klimaschutz dem „Greenwashing“ Tür und Tor geöffnet wird.

Die letzten der 23 Ziele bis 2030 handeln von erhöhter Sicherheit im Umgang mit gentechnisch veränderten Organismen, stärkerer allgemeiner Entwicklungshilfe, der Bedeutung der Wissenschaft und einem nötigen Schub für die Rechte von Frauen und Mädchen, Indigenen und von Menschen, die für umweltbezogene Menschenrechte eintreten.
Wer stellt nun sicher, dass das Abkommen auch umgesetzt wird?
Einige der größten Knackpunkte werden nicht direkt im Rahmenabkommen, sondern in flankierenden Dokumenten geregelt. Denn wie soll nun sichergestellt werden, dass die Ziele nicht nur einmalig 2022 in Montreal beschlossen wurden, nur um dann ab 2023 in Schubladen und auf Festplatten zu verschwinden. Wie wird überwacht, dass die Ziele wirklich umgesetzt werden? Der letzte Anlauf zum Schutz der Biodiversität in den Jahren 2010 bis 2020 hat massiv darunter gelitten, dass ein effektives Monitoring und auch die für politisches Handeln nötige Aufmerksamkeit gefehlt haben.
Nun soll nach einheitlichen und transparenten Kriterien und Indikatoren eine „synchronisierte und wiederkehrende“ Überprüfung organisiert werden. Damit sollen ausbleibende oder erreichte Fortschritte dokumentiert, überprüft und auch zur Debatte gestellt werden. Harte Sanktionen oder Strafen muss aber kein Staat fürchten: Das Kunming-Montreal-Abkommen beruht auf Freiwilligkeit.
Und gleichzeitig sind die Kräfte, die dazu führen, dass in diesem und jedem anderen Moment weltweit naturbelassene Wälder abgeholzt, Feuchtgebiete trockengelegt und giftige Abfälle in der Natur deponiert werden, so stark wie je. Umso stärker müsste jetzt die Gegenbewegung ausfallen, mit politischen Reformen, die jeder Politikbereich, jede Firma und auch jede Bürgerin und jeder Bürger bemerkt.

Bis zur nächsten Vertragsstaatenkonferenz 2024 in der Türkei soll erst feststehen, wie die Überprüfung diesmal besser funktionieren kann als im vergangenen Jahrzehnt. Zumindest einige der Indikatoren für den Fortschritt sind in großer Zahl in Anhängen zum Abkommen schon ausführlich beschrieben. Sie reichen von der Flächenausdehnung der Korallenriffe über die Zahl der ausgestorbenen Arten bis zu Dollarangaben für Naturschutzbudgets und Landbesitz von indigenen Gemeinschaften.
In 2384 Tagen schlägt die Stunde der Wahrheit
Manches muss aber auch neu verhandelt werden, weil bereits bestehende klare numerische Ziele im Laufe der zähen Montreal-Verhandlungen wieder aus den Texten geflogen sind. So scheiterte die EU mit dem Vorhaben, die Fläche konkret zu benennen, die bis 2030 weltweit renaturiert werden muss: sechs Millionen Hektar lautete der EU-Vorschlag dazu.
Das Ziel, bis Ende 2022 ein Abkommen zu erreichen, haben die Staaten erreicht. Nun beginnt ein neuer Countdown, um den Masterplan für die Biosphäre mit Leben zu erfüllen und umzusetzen. Er läuft schon.
2026 sollen die 196 Staaten ihren ersten großen Zwischenbericht vorlegen. Am 30. Juni 2029 ist der Abschlussbericht für die Ziele fällig, die bis 2030 erreicht sein sollen.
Für diesen Kraftakt der gesamten Menschheit stehen, seitdem der chinesische Umweltminister Huang Runqiu den Beschluss von Montreal mit seinem Holzhammer besiegelt hat, 78 Monate zur Verfügung. Das sind nur 2384 Tage, um nach mehreren Jahrhunderten der Ausbeutung und Zerstörung der Biodiversität den Kurs grundlegend zu ändern und die Menschheit in Richtung der vielbeschworenen „Harmonie mit der Natur“ zu bewegen.
Bhm Vmckmvckmt er bhmomi Amhpvgy frvbmt udt bmv KmvhtyoOphxprty Tgprv rtb Imtock ymxoovbmvpo